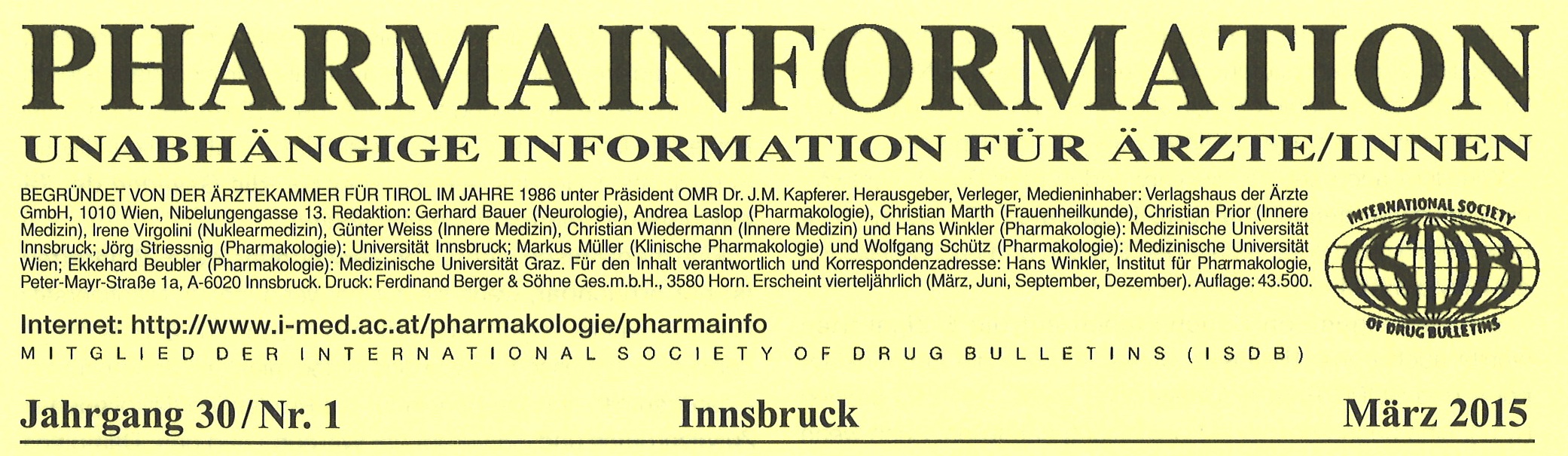
Inhalt
- E-Zigaretten
- Patient-Reported Outcomes (PRO’s)
- NICE guideline für Osteoarthritis
- Tapentadol (Palexia)
- Umstrittene Präparate (u.a. Ezetrol, Inegy)
E-Zigaretten
Wir haben mehrfach (z.B. Pharmainfo XXVIII/3/2013; XXVI/4/2011) betont, dass Rauchen die am häufigsten tödliche Suchtform darstellt, auch PassivraucherInnen schädigt und, wenn man den Stärkegrad der Abhängigkeit gegenüber Nikotin betrachtet, diese Substanz eigentlich als „hard drug“ und sicherlich nicht als Genussmittel zu bezeichnen ist. Mit der Markteinführung der elektrischen (elektronischen) Zigarette postulieren manche, dass man damit diese Sucht in den Griff bekommen oder sie zumindest weniger schädlich machen kann (1).
Repräsentieren diese Zigaretten daher einen glücksbringenden „Phönix“ (1) aus der Zigarettenasche oder haben andere (2) recht, die darin ein „trojanisches Pferd“ sehen?
Wir wollen die wichtigsten Fakten in der sich rasch verändernden Szene festhalten.
In der E-Zigarette wird mit Hilfe einer Wärmequelle eine Nikotinlösung (in Propylenglykol und/oder Glycerin) meist zusammen mit Aromastoffen (z.B. Vanille, Kirsche, Schokolade: 3) verdampft und dieser Dampf wird eingeatmet, die BenutzerInnen „dampfen “ oder „vapen“.
Die technische Entwicklung von E-Zigaretten führt zu „devices“, die zu rascherer Anflutung von Nikotin und zu höheren Blutspiegeln führen. Während ältere Modelle auch nach 35 Minuten Dampfen nicht jene Blutspiegel erreichten, die durch Rauchen schon in 5 Minuten erzielbar waren, ist dies mit neueren Modellen möglich (4). Nicht zu beantworten ist derzeit die Frage, wie diese Entwicklungen die Akzeptanz der E-Zigaretten gegenüber konventionellen erhöhen und das Suchtpotential verändern.
Für den Dampf der E-Zigaretten wird postuliert, dass er abgesehen von der Nikotinabhängigkeit weniger Schäden für den „Dampfer“ zur Folge hat. Tatsächlich sind in ihm nur minimale Konzentrationen von Carcinogenen und toxischen Stoffen zu finden (5-7). Ob das Lösungsmittel Propylenglykol, für das keine negativen Effekte bekannt sind, bei jahrelangem Kontakt mit der Lunge z.B. bei AsthmatikerInnen oder COPD-Kranken harmlos ist, ist unklar (siehe 7a). Das weitgehende Fehlen carcinogener und toxischer Stoffe sollte das Lungenkarzinom- aber auch das COPD-Risiko reduzieren. Dies beruht allerdings auf der Annahme, dass Nikotin selbst keine carcinogene Wirkung hat, was meist als erwiesene Tatsache hingestellt wird (z.B. 8), allerdings gibt es fundierte Gegenstimmen (9).
Bezüglich möglicher kardiovaskulärer Probleme, insbesondere Herzinfarkt, hat anscheinend eine Diskussion noch nicht wirklich begonnen; es wird meist darauf verwiesen, dass nur unzureichende Daten vorliegen (10). Für die Auslösung von Herzinfarkten dürfte allerdings Nikotin hauptverantwortlich sein, auch wenn das bei RaucherInnen erhöhte CO-Hämoglobin einen Beitrag leisten könnte. Bezüglich Nikotin wird betont, dass Nikotinersatzpräparate (NRT: z.B. Pflaster) bezüglich kardiovaskulärer Nebenwirkungen als sicher gelten. Tatsächlich stellt ein Cochrane Review (11) fest, dass es keine Evidenz für die Auslösung von Herzinfarkten gibt, allerdings wurde in den Studien vermehrt Brustschmerz und Herzklopfen unter NRT registriert (OR 1,88; 95% CI 1,37 – 2,57). Diese Aussagen beruhen aber auf Daten von Kurzzeitstudien mit Präparaten mit relativ niedrigem Nikotingehalt und was für die meisten (Ausnahme Spray) zutrifft mit einer langsameren Anflutung von Nikotin im Organismus. Sie sagen nichts aus über einen jahrelangen Gebrauch von E-Zigaretten, bei denen die Entwicklung in Richtung einer erhöhten Freisetzung von Nikotin und einer schnelleren Anflutung geht (siehe unten). Es sei daran erinnert, dass erst nach vielen Jahrzehnten intensiven Rauchens in der Bevölkerung eine große epidemiologische Studie (12) bei Ärzten (nur Männer!) in England belegte, dass Rauchen zu einer Erhöhung des Herzinfarktrisikos bei unter 45jährigen um das 10fache und bei unter 65jährigen um den Faktor von ca. 2 führte, bei über 65jährigen wurde das Risiko bei einer hohen Basisinfarktrate nur mehr gering erhöht.
Es ist einfach fahrlässig, mit einem ungeregelten Zugang zu E-Zigaretten möglicherweise die Geschichte der späten Erkenntnis von kardiovaskulären Schäden durch Nikotin-Zigaretten zu wiederholen.
Zur Frage des noch sehr wenig untersuchten Passivrauchens zeigt eine rezente Studie (13), dass es bei Personen, deren PartnerInnen im Haushalt E-Zigaretten verwenden, zur Nikotinaufnahme (gemessen an der Cotinin-Konzentration im Harn) kommt, die vergleichbar zu Haushalten mit konventionellen RaucherInnen ist (siehe auch 14). Offensichtlich spielt auch bei der E-Zigarette die Aufnahme von Nikotin (aus der Ausatmungsluft der Dampfer) für die Personen in der Umgebung eine Rolle, und damit kann ein Risiko für kardiovaskuläre Folgen für diese Personen gegeben sein.
Wenn wir das bisher Gesagte zusammenfassen, dann sind E-Zigaretten aufgrund des Nikotingehaltes Suchtmittel, der Dampf dieser Zigarette mit weniger Schadstoffen sollte ein geringeres Lungenkarzinomrisiko bedingen, bezüglich kardiovaskulärer Folgen wie Myokardinfarkt ist keine Aussage möglich.
E-Zigaretten werden als Raucherentwöhnungsmittel propagiert. In einer Studie (15) mit 657 RaucherInnen waren nach 6 Monaten 7,3% der RaucherInnen mit E-Zigaretten (Nikotinhältig) abstinent, mit Nikotinpflaster 5,8%, mit elektronischer Zigarette ohne Nikotin 4,1% (nicht signifikante Unterschiede). Diese Daten und auch solche von weiteren Studien (siehe 16) lassen derzeit keine verlässlichen Schlüsse zu, deutlich bessere Resultate als mit Nikotinersatzpräparaten wurden bis jetzt nicht erzielt. An sich wäre zu erwarten, dass mit E-Zigaretten, die zusätzlich zur Nikotinzufuhr, wie sie z.B. auch das Nikotinpflaster macht, einen subjektiv den Zigaretten ähnlichen „Rauchvorgang“ imitieren, höhere Abstinenzraten zu erzielen sind.
Wie dem auch sei, für die Verwendung zur Raucherentwöhnung müssten genau definierte Präparate (z.B. bezüglich Nikotingehalt) nach entsprechenden Studien und nach Zulassung als Arzneimittel eingeführt werden.
Ein Umsteigen von RaucherInnen auf die E-Zigaretten würde auch ohne Abstinenz wahrscheinlich die Lungenkarzinom- und COPD-Rate reduzieren und damit, wie viele meinen (1,17), eine begrüßenswerte Entwicklung darstellen. Auch wenn wir über die Langzeitsicherheit der E-Zigaretten praktisch noch nichts wissen, erscheint dieses Argument zuerst einmal überzeugend. Tatsächlich gibt es aber noch keine verlässlichen Daten, ob ein solches Umsteigen tatsächlich funktioniert. Vielmehr zeigt sich, dass ein beträchtlicher Teil schließlich einen „dual use“ durchführt (z.B. wie in einer US-Studie bei StudentInnen: 49,8%: 18) und dann die E-Zigaretten in Bereichen verwendet, wo Rauchen von Zigaretten verboten ist. Weiters wurde gezeigt, dass E-Zigaretten nicht nur von RaucherInnen verwendet werden, sondern dass die Zahl der Neueinsteiger im Steigen begriffen ist. So hatten in einer US-College Studie 12% der E-Zigaretten-VerwenderInnen noch nie vorher geraucht (19) und eine andere Studie zeigt, dass 43,9% der NeueinsteigerInnen auch die Intention haben, konventionelle Zigaretten zu rauchen (20). E-Zigaretten sind daher keineswegs nur eine Umstiegsdroge, sondern oft eine Zusatzdroge und sogar eine Einstiegsdroge.
In dieser komplexen und volatilen Diskussion ist noch ein weiterer wesentlicher Faktor zu bedenken. E-Zigaretten wurden ursprünglich von einer kleinen chinesischen Firma produziert, dann haben zahlreiche Firmen die Produktion übernommen und in den letzten Jahren sind die großen Tabakkonzerne eingestiegen.
Die Intentionen dieser Konzerne sind aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit vorauszusehen. Sie sind nicht interessiert, E-Zigaretten als Entwöhnungsmittel zu propagieren, ein Umstieg wäre noch tolerierbar, tatsächlich erhofft man sich aber eine Renaissance des Rauchens und damit wieder steigende Umsätze (21). Die Tabakindustrie wird versuchen, durch Erhöhung des Nikotingehaltes und der Nikotinfreisetzung und durch Zugabe von Aromastoffen, welche die Annehmlichkeit steigern (so wie in der Vergangenheit durch die Zugabe von Menthol zu den Zigaretten – was z.B. erst jetzt in Europa verboten wird), die E-Zigaretten bzw. die Abhängigkeit von ihnen zu fördern (22).
Das wahre Ziel hinter der „smoke screen“ E-Zigarette dürfte aber darin liegen, Rauchen generell wieder „gesellschaftsfähig“ werden zu lassen, to „re-normalise it“ oder „glamorise it“ (2,23). Die Kampagne hat schon begonnen, so wie vor Jahren für das Rauchen erscheinen jetzt für E-Zigaretten sehr positiv gefärbte Artikel, deren AutorInnen heute allerdings finanzielle Kontakte zu den E-Zigaretten-Firmen deklarieren müssen (z.B. 17). So werden auch „Prosmoking“ Gruppen in den USA von der Tabakindustrie unterstützt, ihr Slogan ist: Eat, drink, smoke, vape - it is your choice (24).
Seit Jahren versuchen die Gesundheitsbehörden die Nikotinsucht einzugrenzen. Da die Erfolgsraten für Abstinenz bei den bereits Suchtkranken sehr gering sind, geht es vor allem darum, die Jugendlichen von einem Einstieg abzuhalten. Dies kann letztlich nur durch die Marginalisierung des Rauchens in der Gesellschaft gelingen, wobei dies sehr viel Verständnis von den RaucherInnen abverlangt, aber im Interesse der zu schützenden nächsten Generation wichtig ist. Wenn es aber gelingt, E-Zigaretten für Jugendliche als cool, fashionable oder sexy zu propagieren, gleichzeitig sie auch als harmlos darzustellen, dann dürfte die Rechnung aufgehen, dass „Dampfen“ und in der Folge das letztlich doch (durch raschere Anflutung von Nikotin: 3) noch mehr Genuss liefernde Rauchen die Gewinne der Tabakindustrie wieder ansteigen lassen.
Eine medizinisch sinnreiche Verwendung der E-Zigaretten ist nur erreichbar, wenn sie zur Verwendung als Nikotinersatz als Arzneimittel registriert werden müssen. Für eine sonstige Verwendung müssen, so wie dies in den meisten Ländern für die Zigaretten gilt, strenge Regeln für die Produktion (Nikotingehalt, Zusatzaromen und ein Verbot der Werbung und des „Dampfens“ in allen öffentlichen Räumen) vorgeschrieben werden. Dies sind alles Maßnahmen, die in unterschiedlicher Weise derzeit von der FDA, der EU und einzelnen Ländern bereits eingeführt oder geplant werden (7a,21,25-27, für eine Gegenstimme siehe 28). Offensichtlich haben Politik und Gesundheitsbehörden etwas aus der Geschichte gelernt und im Gegensatz zu den Trojanern wollen sie nicht ein trojanisches Pferd unkontrolliert in den Markt lassen. Zumindest ermöglichen restriktive Maßnahmen Zeit zu gewinnen, bis verlässlichere Daten vorliegen, und auch Troja wäre ja nicht gefallen, wenn man das Pferd nur ein paar Tage vor den Toren hätte stehen lassen.
Literatur:
(1) Brit J Gen Practice 64,442,2014
(2) Psychiatr Bull 38,201,2014
(3) JAMA 312,2493,2014
(4) Scient Rep 4,4133,2014
(5) Tob Control 23,133,2014
(6) Nic Tob Res, S.Hecht et al, 21 Oct 2014, online
(7) BMC Public Health 14,18,2014
(7a) Am J Resp Crit Care Med 190,711,2014
(8) Int J Cancer 131,2724,2012
(9) Nat Rev 14,419,2014
(10) Circulation 130,1418,2014
(11) Cochrane Database Syst Rev Issue 11,CD000146,2012
(12) BMJ 2,1525,1976
(13) Envir Res 135,76,2014
(14) Nic Tob Res 16,655,2014
(15) Lancet 382,1629,2013
(16) Ann Pharmac 48,1502,2014
(17) Ther Adv Drug Saf 5,67,2014
(18) JAMA Pediatr 168,610,2013
(19) Drug Alc Dep 131,214,2013
(20) Nic Tob Res 17,228,2015
(21) BMJ 349,g5512,2014
(22) JAMA 312,1289,2014
(23) BMJ 349,g6444,2014
(24) BMJ 349,g6618,2014
(25) Nature 513,24,2014
(26) JAMA 310,685,2013
(27) NEJM 371,1469,2014
(28) Addiction 109,1801,2014
Patient-Reported Outcomes (PROs) und gesundheitsbezogene Lebensqualität in der Onkologie
Eva-Maria Gamper, Universitätsklinik für Nuklearmedizin, Innsbruck
Nachdem in der Evaluation onkologischer Therapien lange Zeit ausschließlich Überlebenszeit und Morbidität die ausschlaggebenden Kriterien waren, ist in den vergangenen Jahrzehnten das Bewusstsein für die Notwendigkeit subjektiver Parameter zu Gesundheitszustand und Behandlungsauswirkungen gewachsen. Das Bemühen um eine verstärkte Berücksichtigung der PatientInnenperspektive schlägt sich in Positionspapieren und Richtlinienentwürfen von Institutionen wie denen des US-amerikanischen National Cancer Institute (NCI) oder der Food and Drug Administration (FDA) nieder, die den Einsatz der sogenannten Patient-Reported Outcomes (PROs) in klinischen Studien fordern und fördern (1,2). Auch die European Medicines Agency (EMA) kündigt in ihren Leitlinien zur Evaluierung von Krebsmedikamenten von 2013 die Nachreichung eines Zusatzes über den Einsatz von PROs an (3).
Die von der FDA formulierte Definition beschreibt ein PRO wie folgt: “A PRO is a measurement of any aspect of a patient’s health status that comes directly from the patient (i.e., without the interpretation of the patient’s responses by a physician or anyone else).” (2). Hier ist auch der Begriff der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (health-related quality of life – HRQOL) einzuordnen, der sowohl Symptome und physische Funktionsfähigkeit als auch soziale, emotionale sowie eine Reihe weiterer Belange im Zusammenhang mit Erkrankung und Behandlung umfasst. Diese Informationen werden üblicherweise mittels Fragebögen eingeholt, die der/die PatientIn selbstständig ausfüllt.
PROs in der onkologischen Forschung
Wie oben angeführt, ermöglichen PRO-Daten eine systematisierte Bewertung von Therapien aus PatientInnensicht. Studien bescheinigen PROs eine genauere Beschreibung von Symptomen und Nebenwirkungen, sowie bessere Sensitivität für Veränderungen über die Zeit im Vergleich zu den traditionellen Fremdeinschätzungen durch den/die Arzt/Ärztin (4,5). Ein Beispiel hierfür findet sich bei der Bewertung von Nebenwirkungen von Aromatasehemmern bei postmenopausalen Frauen mit Mammakarzinom. Die PRO-Beth-Studie (PROs in breast cancer patients undergoing endocrine therapy) zeigte eine signifikant höhere Prävalenz von Gelenksschmerzen, Hitzewallungen, nächtlichem Schwitzen, Fatigue und Stimmungsschwankungen als aufgrund von ÄrztInnenratings aus den Zulassungsstudien zu erwarten gewesen wäre. Die Unterschiede in den Prävalenzen dieser Symptome zwischen ÄrztInnenratings und PROs betrugen zwischen 14% und 39%. Außerdem ging aus den PROs hervor, dass mangelnde Libido, die in den ÄrztInnenratings nicht mit berücksichtig wurde, zu den häufigsten Beschwerden in dieser Patientinnengruppe zählte (6). Derartige Daten machen deutlich, wie wichtig bereits in der Zulassung von Substanzen nicht nur die Einschätzung von Nebenwirkungen durch die Behandelnden, sondern auch die direkte Bewertung durch die Patientinnen ist.
Verwendung von PROs in der klinischen Praxis
PROs verändern nicht nur die onkologische Forschungspraxis. Sie sind zum einen die Basis für eine verbesserte Information hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit und des zu erwartenden Ausmaßes von Beeinträchtigungen durch Krankheit und/oder Behandlung. Dies spielt eine wesentliche Rolle bei Therapieentscheidungen und ist auch im Zusammenhang mit Therapieadhärenz zu betrachten.
Zum anderen rückt derzeit die direkte Verwendung von PROs in der klinischen Praxis zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses. Diese Entwicklung ist vor allem den Möglichkeiten der computerbasierten Datenerfassung zu verdanken. Sowohl im stationären als auch im, während der letzten Jahre verstärkt in die onkologische Behandlung involvierten, ambulanten und niedergelassenen Bereich bietet die routinemäßige elektronische Erhebung von PROs (electronic patient-reported outcome measurement – ePROM) verschiedene Vorteile. Dazu zählt in erster Linie die zeitnahe Identifikation von Belastungen, insbesondere jener Aspekte, die meist weder von PatientInnen noch von Behandelnden initiativ angesprochen werden, wie z.B. sexuelle oder emotionale Probleme. So stellten z.B. Detmar et al. (7) fest, dass bzgl. somatischer Symptome in etwa 17% der PatientInnen und bzgl. Einschränkungen im täglichen Leben, emotionaler und sozialer Belastungen 25-37% der PatientInnen erwarten, dass der Behandelnde diese Themen zur Sprache bringt.
Die praktische Anwendbarkeit von PROs in der klinischen Routine bestätigen sowohl PatientInnen, die ihren aktuellen Gesundheitszustand von PROs zutreffend abgebildet finden und deren Einsatz befürworten, als auch Behandelnde, die Informationen aus PROs als hilfreich in der Gesprächsführung, insbesondere hinsichtlich sensibler Themen erleben. Somit stellt ePROM eine einfache und entgegen den Befürchtungen von Seiten vieler Behandelnder auch eine zeitökonomische Methode dar, Interventionen besser auf die aktuellen Bedürfnisse der PatientInnen abzustimmen.
Wie wichtig der Einsatz von PRO-Befragungen in der Entscheidungsfindung bei Therapien sein kann, zeigt das folgende Beispiel. Koldenhof et al. (8) beschäftigten sich in einer aktuellen Studie mit der Rolle von PROs bei Therapieentscheidungen bei mit Sunitinib (Sutent) oder Sorafenib (Nexavar) behandelten PatientInnen. Die PRO-basierten Prävalenzen von adverse events (AEs) waren deutlich höher als in der Literatur berichtet. Außerdem litten rund 60% der StudienpatientInnen unter multiplen leichten AEs, die sich negativ auf ihre Lebensqualität auswirkten. Die AutorInnen schlagen daher vor, PROs zu verwenden um AEs frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Dies würde sowohl die Lebensqualität der PatientInnen positiv beeinflussen, als auch Dosismodifikationen lenken und möglicherweise dazu beitragen, die Überlebenszeit unter diesen Therapien zu verbessern.
Entgegen der häufig vorherrschenden Meinung, in einer guten Arzt-Patient-Beziehung brächten PROs keinen zusätzlichen Nutzen, konnte außerdem gezeigt werden, dass deren Integration ins Arztgespräch die Qualität der Kommunikation sowie die Behandlungszufriedenheit verbessern kann. Dies mag nicht zuletzt auch daran liegen, dass durch eine gemeinsame Definition von behandlungsrelevanten Bereichen die Hierarchie zwischen Arzt/Ärztin und PatientIn aufgeweicht und die Einbindung der PatientInnen in Therapieentscheidungen erleichtert werden (9). Zudem geht das Gefühl von Kontrolle in einem shared decision-making Prozess mit größerer Behandlungszufriedenheit und weniger stark ausgeprägter Angst, Depression und Fatigue einher (10).
Instrumente zur Erfassung von PROs in der Onkologie
Zur Erfassung von PROs ist eine Reihe gut validierter und international verwendeter Instrumente verfügbar. Neben allgemeinen Fragebögen zu Belastungen, mit denen die Mehrzahl der onkologischen PatientInnen konfrontiert sind (z.B. Schmerzen und Fatigue), wurden verschiedene diagnose-, therapie- und themenspezifische Fragebögen, wie z.B. zur Behandlungszufriedenheit, entwickelt. Diese Fülle an Instrumenten kann für NeuanwenderInnen eine Hürde bei der Suche nach dem geeigneten Instrument darstellen. Als Unterstützung bei der Auswahl hat die International Society for Quality of Life Research (ISOQOL) nun Minimumstandards für PRO-Instrumente definiert (11).
Ein Überblick über PROs und Lebensqualität in der Onkologie findet sich bei Wintner et al. (9). Es sind hier vor allem zwei Fragebogensysteme von internationaler Bedeutung: jenes der European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Group (EORTC QLG) und das Functional Assessment of Chronic Illness (FACIT)–Instrumentarium. Beide Systeme sind in mehreren Sprachen verfügbar und bestehen aus einem Kernfragebogen, dem Quality of Life Questionnaire Core-30 (EORTC QLQ-C30: 12) bzw. dem Functional Assessment of Cancer Therapy - General (FACT-G: 13), der durch spezifische Module für verschiedene PatientInnengruppen und Themenbereiche ergänzt werden kann.
Der Weg vom Fragebogen zu HRQOL-Werten sei anhand des EORTC QLQ-C30 im Folgenden näher erläutert. Das Instrument umfasst 30 Fragen zu körperlichen und psychosozialen Aspekten wie z.B. Schwäche, Konzentrationsprobleme oder Niedergeschlagenheit, welche der/die PatientIn auf einer 4-stufigen Rating-Skala (gar nicht – ein wenig – mäßig – sehr) beantwortet. Diese 30 Fragen werden zu 5 Funktionsskalen (physische, emotionale, kognitive, soziale und rollenbezogene Funktionsfähigkeit), 9 Symptomskalen (Fatigue, Schmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Appetitverlust, Diarrhoe, Konstipation, Dyspnoe, Insomnia und finanzielle Auswirkungen) und einer Skala zur allgemeinen Lebensqualität zusammengefasst. So bilden beispielsweise die vier Fragen „Haben Sie sich Sorgen gemacht?“, „Waren Sie niedergeschlagen?“, „Waren Sie reizbar?“ und „Waren Sie angespannt?“ die Skala „Emotionale Funktionsfähigkeit“, indem die Scorepunkte der einzelnen Fragen summiert und gemittelt werden. Um die Ergebnisse besser darstellbar zu machen, werden diese Skalenwerte anschließend auf einem Spektrum von 0-100 aufgetragen, wobei für Symptomskalen null und für Funktionsskalen 100 das Optimum ist. So können Unterschiede der auf diese Bereiche bezogenen Lebensqualität zwischen verschiedenen Therapien, sowie Veränderung über die Zeit und Abweichungen von Werten der Allgemeinbevölkerung ermittelt werden.
In der Berechnung derartiger Unterschiede wird auch versucht, neben der statistischen Signifikanz die klinische Relevanz zu berücksichtigen. Für den EORTC QLQ-C30 wurden beispielsweise auf Grundlage von Interviews mit PatientInnen klinisch relevante Unterschiede definiert, die Änderungen von 5-10 Punkten auf der Skala von 0-100 als klein, von 10-20 als moderat, und von >20 als groß beschreiben (14). Es herrscht derzeit jedoch noch Uneinigkeit, welche Bedeutung diesen für den/die Patienten/in relevanten Unterschiede in der Interpretation von Gruppenunterschieden zukommt (15).
Zusammenfassung
PROs sind heute etablierte und zuverlässige Parameter in der PatientInnen-orientierten, onkologischen Versorgung. Sie beschreiben Nebenwirkungsspektren von Therapien aus der Perspektive der PatientInnen und ermöglichen, beim Einsatz in der klinischen Praxis, eine unmittelbare Erfassung von Symptomen und Funktionseinschränkungen. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf das Symptommanagement aus, sondern ist auch der Arzt-Patient-Beziehung zuträglich und erhöht die Behandlungszufriedenheit – möglicherweise sogar nicht nur auf Seiten der PatientInnen.
Literatur:
(1) J Clin Oncol 32,25,2007
(2) FDA, Guidance for Industry,2009
(3) EMA (CHMP), Guidelines on the evaluation of anticancer medicinal products in man, 2013
(4) J Natl Cancer Inst 23,101,2009
(5) Haematologica 4,99,2014
(6) Breast Cancer Res Treat 2,128,2011
(7) J Clin Oncol 18,18,2000
(8) Support Care Cancer 22,2371,2014
(9) Wien Klin Wochenschr 9-10,124,2012
(10) Cancer 12,120,2014
(11) Qual Life Res 8,22,2013
(12) J Natl Cancer Inst 5,85,1993
(13) J Clin Oncol 3,11,1993
(14) J Clin Oncol 1,16,1998
(15) Med care 39,10,2001
NICE guideline for osteoarthritis
Die englische Institution NICE (National Institute of Health and Clinical Excellence) hat 2014 eine neue Guideline für Osteoarthritis im Umfang von 461 Seiten mit mehr als 500 References publiziert (im Internet abrufbar; siehe auch in USA Medical Letter mit analogen Empfehlungen: 1). Wir wollen im Folgenden diskutieren, inwieweit diese umfangreiche Bewertung unsere Ausführungen zu diesem Thema bestätigt, ergänzt oder auch widerspricht.
NICE Empfehlung: "Paracetamol and/or topical NSAID (NSAR: Nicht-steroidale Anti-Rheumatika) should be considered ahead of oral NSAID/COX2 inhibitors or opioid"
Diese first line-Empfehlung für Paracetamol (Ben-u-ron, Mexalen, Generika), das keine gastrointestinalen und kardiovaskulären Nebenwirkungen und laut NICE eine mit NSAR vergleichbare Wirkung hat, wurde von uns bereits mehrfach betont (siehe Pharmainfo XXIII/3/2008; XXVIII/3/2013). Allerdings ist eine kontinuierliche (siehe NICE) Therapie und eine ausreichende Dosierung mit der in Österreich gegebenen Tagesmaximaldosis von 2g (4 Tabletten à 500 mg) wichtig (in den meisten Ländern ist diese Dosis 4g, so wie für das parenterale Präparat (Perfalgan) auch in Österreich). Lebertoxizität tritt erst bei höheren Dosen (über 6g) auf (allerdings Vorsicht bei höherem Alkoholkonsum).
Für eine Subgruppe der Gelenk- und Muskelschmerzen, nämlich den schwer behandelbaren „Kreuzschmerzen“ (low back pain) hat eine rezente Studie (1a, n = 999) für Paracetamol weder bezüglich der akuten Schmerzlinderung, als auch für die „Recovertime“ einen positiven Effekt versus Plazebo finden können. Eine Cochrane Analyse (1b; zahlreiche Studien) fand allerdings für NSAR und Paracetamol („moderate evidence“ dass „equally effective) auch bei dieser Indikation einen positivenEffekt („although effects are small“).
Über die topische Therapie, die von NICE zusätzlich zu Paracetamol oder auch als first line-Therapie empfohlen wird, haben wir bis jetzt keine Bewertung abgegeben. Bei topischen Applikationen wird eine Substanz wie Diclofenac (Generika) nur in sehr geringen Mengen durch die Haut aufgenommen, Konzentrationen in oberflächennahen Geweben sind hoch variabel und stark abhängig vom jeweiligen Applikationsort, von der individuellen Hautbeschaffenheit sowie vom spezifischen Produkt (2-7), im therapeutisch relevanten periartikulärem Gewebe wurden aber auch signifikante Konzentrationen gefunden (8). Tatsächlich sprechen ausreichende klinische Studien zumindest für einige Präparate dafür, dass lokal wirksame Konzentrationen im Gewebe erreichbar sind.
Ein Cochrane Review wertete 34 Studien mit 7.688 PatientInnen aus (9). Untersucht wurden mehrere NSAR, allerdings waren nur für Diclofenac ausreichende Unterlagen vorhanden, während für andere NSAR wie Ibuprofen, Flufenaminsäure, Indomethacin und Ketoprofen keine verlässliche Bewertung möglich war. Als Primärparameter wurde eine klinisch relevante Schmerzreduktion von über 50% herangezogen, wobei sich für Diclofenac (Lösung, Gel oder Pflaster zur topischen Applikation) nach 2 – 3 Wochen Behandlung eine NNT (number needed to treat) von 5,0, nach 4 – 6 Wochen von 5,2 und nach 8 – 10 Wochen von 10 ergab. Anders ausgedrückt war die Schmerzreduktion nach 2 – 3 Wochen bei 40% in der Diclofenac-Gruppe bzw. 20% in der Placebogruppe zu sehen, nach 8 – 10 Wochen war der Unterschied mit 60% zu 50% geringer. Diese Daten gelten vor allem für osteoarthritische Schmerzen an der Hand und im Knie.
In Österreich sind für Diclofenac zahlreiche topische Präparate (Gele: Algefit, Deflamat, Diclobene, Diclofenac, Diclostad, Diclosyl, Solaraze, Voltadol, Voltaren; Pennsaid Lösung; Pflaster: Dolostrip, Flector EP), für Ibuprofen (Dolgit, Ibutop Creme), Indomethacin (Luiflex Spray), Flufenaminsäure (Mobilisin) und Ketoprofen (Fastum, Ketospray) auch einige registriert. Am besten untersucht ist Diclonfenac (siehe oben), inwieweit die jeweils unterschiedliche Galenik der registrierten Präparate und individuelle Gegebenheiten die klinische Wirkung im konkreten Fall beeinflussen, kann nur durch „Ausprobieren“ sichergestellt werden. Gegen Ketoprofen spricht, dass es schwere photoallergische Reaktionen auslösen kann (EMA referral: 29. November 2010) und daher Sonnenlicht vermieden werden muss.
Zusammenfassung: die Empfehlung Paracetamol als Mittel erser Wahl bei Osteoarthritis zu verwenden, bestätigt bzw. ergänzt frühere Diskussionen in der Pharmainfo. Die Datenlage zu topischen NSAR ist weniger robust. Die lokale Penetration ist sehr variabel und abhängig von der jeweiligen Galenik. Wir sehen daher topische NSAR nicht als Mittel der ersten Wahl. Wenn aber eine Paracetamolgabe nicht ausreicht, ist ein Versuch mit der zusätzlichen Gabe von topischen NSAR Präparaten (bevor orale gegeben werden) bzw. auch deren alleinige Gabe vertretbar.
Weitere Empfehlungen von NICE: "Wenn Paracetamol und topische NSAR nicht ausreichend wirken, können orale NSAR und COX-2-Hemmer zusätzlich oder an ihrer Stelle verwendet werden, und zwar in der niedrigst wirksamen Dosis und für die kürzest mögliche Zeit."
NSAR und COX-2-Hemmer sollten mit dem ökonomisch günstigsten Protonenpumpenhemmer kombiniert werden (diese Kombination ist auch die kostengünstigste Vorgangsweise, da sie Kosten-verursachende Komplikationen verhindert).
Eine Auswahl zwischen den Präparaten, die alle analgetisch vergleichbar wirken, ist aufgrund ihrer kardiovaskulären und gastrointestinalen Toxizität individuell auf den/die Patienten/in, insbesondere auch sein/ihr Alter bezogen, vorzunehmen.
Das erhöhte kardiovaskuläre Risiko für spezifische COX-2-Hemmer wie Celecoxib (Celebrex) und Etoricoxib (Arcoxia) ist bereits länger bekannt, inzwischen ist dies aber auch für vorwiegende COX-2-Hemmer wie Diclofenac (Generika) und auch Meloxicam (Movalis, Generika) belegt (Pharmainfo XXVIII/3/2013). Die sich daraus ergebenden Kontraindikationen und Warnhinweise schränken die Indikation für diese Substanzen, insbesondere bei älteren Personen, die zu einem beträchtlichen Teil kardiovaskulär belastet sind, deutlich ein.
Naproxen (Proxen, Generika) und zumindest niedrige Dosen von Ibuprofen (Brufen, Generika) scheinen keine oder geringe kardiovaskuläre Risiken zu zeigen (Pharmainfo XXIII/3/2008; XXVIII/3/2013).
Die von NICE empfohlene Kombination mit Protonenpumpenhemmern reduziert für alle Substanzen das gastrointestinale Risiko, bei COX-2-Hemmern wird damit das geringste Risiko erreicht. Bei PatientInnen mit hohem gastrointestinalen Risiko kann daher ein COX-2-Hemmer in dieser Kombination, wenn kein kardiovaskuläres Risiko gegen den Einsatz spricht, von Vorteil sein.
Glucosamin (Dona, Flexove, Progona, Tavimin), Chondroitinsulfat (Condrosulf) und Hyaluronsäure (Artzal, Hyalgan).
Für diese Substanzen ist die klare Aussage von NICE: Do not offer these substances for the management of osteoarthritis. Begründung: Ein klinisch relevanter Nutzen für diese Mittel ist nicht belegt (vgl. dazu Pharmainfo XXII/4/2007; XXIII/3/2008, siehe auch rezenteste Studie zu Glucosamin: 10). Gegen eine Verwendung der intraartikulär zu injizierenden Hyaluronsäure spricht zusätzlich noch das Risiko von unangenehmen Gelenksinfektionen.
Zusammenfassung
Paracetamol ist Mittel erster Wahl, kombiniert mit topischen NSAR als zweite Möglichkeit. Nachdem orale NSAR über viele Jahre präferentiell und millionenfach verschrieben wurden, ist heute die Risiko/Nutzen-Bewertung dieser Präparate und damit ihr Einsatz durch Verunsicherung gekennzeichnet. Ob Opioide (in der NICE guideline nicht im Detail behandelt) vermehrt ihren Platz einnehmen können, ist zu diskutieren. Schwach wirksame Opioide sind vorzuziehen, starke Opioide sollten nur in Einzelfällen verwendet werden (siehe Empfehlung einer Rheumatologendiskussiongruppe: 11). Allerdings hat in den USA schon die Diskussion begonnen, inwieweit ein Einsatz von Opioiden bei Nicht-Karzinom-Schmerz zu erhöhten Suchtproblemen führt (12), auch ein erhöhtes Sturzrisiko bei älteren PatientInnen ist zu beachten (13)
Literatur:
(1) Medical Letter 56,80,2014
(1a) Lancet: CM Williams online July 24
(1b) Cochrane Database Syst Rev 2 CD00075320,2014
(2) Br J Clin Pharmacol 31,537,1991
(3) Int J Clin Pharmacol Ther 421,353,2004
(4) Br J Clin Pharmacol 71,852,2011
(5) Br J Clin Pharmacol 60,573,2005
(6) Br J Clin Pharmacol 76,880,2013
(7) J Clin Pharmacol Ther 62,293,1997
(8) Aktuelle Rheumatol 21,298,1996
(9) Cochrane Database Syst Rev issue 9,2012
(10) Arthr Rheum 66,930,2014
(11) Rheumatol 51,1416,2012
(12) JAMA 308,457,2012
(13) JAMA 312,825,2014
Tapentadol (Palexia retard)
Diese Substanz ist indiziert für starke, chronische Schmerzen, die nur mit Opioiden angemessen behandelt werden können (Suchtgiftrezept).
Tapentadol wurde nicht mit dem zentralen europäischen Verfahren, sondern über das dezentrale Verfahren (mit Deutschland als Referenz- und damit auch als Begutachterstaat) zugelassen. In den letzten Jahren wählt kaum mehr eine Firma für neue Substanzen diesen Zulassungsweg, der weniger transparent (kein öffentlich zugänglicher EPAR) ist und auch nicht dem relativ hohen Standard der Zulassung in London entspricht. Es werden daher hier die Studiendaten im Detail und kritisch analysiert.
Tapentadol wird öfters (z.B. 1) als erster Vertreter der Substanzklasse MOR-NRI (µ-Opioid Rezeptor Agonist und Noradrenalin Reuptake Inhibitor) propagiert, tatsächlich hatte diese Eigenschaften bereits Tramadol (Generika, Tramal) der gleichen Firma, für das inzwischen Generika zur Verfügung stehen.
Eine Aktivierung von µ-Rezeptoren reduziert im Rückenmark aufsteigende Schmerzsignale, während eine erhöhte Noradrenalin-Konzentration (durch Wiederaufnahmehemmung in der Synapse) absteigende Bahnen vom Zentralnervensystem zum Rückenmark aktivieren soll. Die µ-Rezeptoren Wirkung soll den akuten Nozizeptorschmerz, die Noradrenalin Komponente den neuropathischen Schmerz beeinflussen (2).
Auf die Nordrenalin Wiederaufnahme wirkt in vitro (Ratten-Synaptosomen) Tapentadol stärker als Tramadol, auf die Serotoninaufnahme gleich. In einem in vivo Mikrodialyse Modell (Ratten) führt Tapentadol über Wiederaufnahmehemmung sowohl zur Freisetzung von Noradrenalin als auch Serotonin, und die Affinität für den menschlichen Noradrenalin bzw. Serotonin Transporter ist ähnlich (3). Behauptungen in der Sekundärliteratur (siehe z.B. 2), dass Tapentadol im Vergleich zu Tramadol „minimale Aktivität“ auf die Serotonin Aufnahme hätte, entsprechen nicht diesen Originaldaten.
Klinisch wurde die Wirkung von Tapentadol auf akute Schmerzen in drei Firmenstudien getestet. Nach einer Zahnoperation wurde Tapentadol (25 bis 200 mg) mit Morphin (60 mg: Generika, Mundidol) verglichen (n = 400: 4). Die analgetische Wirkung der höchsten Tapentadol Dosis war vergleichbar mit der von Morphin. Bei den Nebenwirkungen waren für Tapentadol im Vergleich zu Morphin Nausea und Erbrechen numerisch seltener, Schwindel gleich, Benommenheit, Atemdämpfung und Schwitzen häufiger. In der zweiten Studie (n = 603: 5) wurde nach einer orthopädischen Operation Tapentadol (50 – 100 mg alle 4 – 6 Stunden bis 72 Stunden) mit Oxycodon (15 mg: Generika, Oxycontin) verglichen. Die analgetische Wirkung von 100 mg Tapentadol und 15 mg Oxycodon war vergleichbar, und so war auch die Gesamtnebenwirkungsinzidenz (85% versus 87%). Numerisch niedriger für Tapentadol waren Nausea (49% versus 67%), Erbrechen (32% versus 42%) und Obstipation (10% versus 15%), Schwindel war gleich und Benommenheit (21% zu 10%) war höher. Ähnliche Daten für postoperative Schmerzen wurden in einer dritten Studie (n = 906: 6) erhalten.
Bei akuten Schmerzen kommt es bei äquianalgetischen Dosen von Tapentadol weniger häufig als bei Morphin bzw. Oxycodon zu Nausea, Erbrechen und Obstipation, da aber für diese Nebenwirkung eine sehr starke Dosisabhängigkeit besteht und in den einzelnen Studien nur jeweils eine Dosis der Vergleichssubstanz getestet wurde, ist eine verlässliche Aussage nicht möglich.
Für chronische Schmerzen (Osteoarthrose) ergab eine relativ kurze Studie von 10 Tagen (n = 659: 7) eine gleich gute analgetische Wirkung von 50 mg und 75 mg Tapentadol im Vergleich zu 10 mg Oxycodon (alle 4 – 6 Stunden). Nausea, Erbrechen und Obstipation waren für Oxycodon häufiger.
Von zwei längeren Studien (8,9,9a) wird wegen ähnlichem Design und Resultaten nur eine (8) besprochen. Osteoarthrose PatientInnen (n = 1023) wurden nach einer dreiwöchigen Dosistitrationsphase für 12 Wochen mit Tapentadol retard oder Oxycodon behandelt. Die mittleren Tagesdosen für die 12 Wochen Periode betrugen 350 mg Tapentadol und 70 mg Oxycodon. Studienabbrüche waren häufig: 38,6% in der Placebogruppe (vor allem wegen Nichtwirksamkeit), 42,7% in der Tapentadol- und 64,6% in der Oxycodongruppe (vor allem wegen Nebenwirkungen). Gastrointestinale und zentralnervöse Nebenwirkungen waren in der Oxycodongruppe häufiger (Nausea/Erbrechen: 40,6% versus 22,7% für Tapentadol, Obstipation 36,8% versus 18,9%; Benommenheit: 19,6% versus 10,8%). Diese Nebenwirkungen führten vor allem in der Titrationsphase zum Studienabbruch (13% für Tapentadol, 40% für Oxycodon), während in der 12-wöchigen Phase nur mehr zusätzlich jeweils 6% für beide Substanzen die Studie verließen. Dies spricht dafür, dass die Oxycodondosen in der Titrationsphase zu brüsk anstiegen (von 2 x 10 mg pro Tag ausgehend, lt. Fachinformation wird auch ein Beginn mit 2 x 5 mg empfohlen um Nebenwirkungen zu minimieren) oder auch die vorgesehene Dosisreduktion wegen Nebenwirkungen nicht optimal durchgeführt wurde.
Bezüglich der analgetischen Wirkung erschienen die beiden Substanzen ähnlich. Dieses Resultat ist aber unverlässlich, wenn man bedenkt, dass eine so große und so unterschiedliche Zahl von PatientInnen ausfiel. Dies führte z.B. dazu, dass die Responderrate (mehr als 50% Besserung) für Oxycodon mit 17,3% der PatientInnen signifikant geringer war als für Placebo (24,3%). Dieses absurde Resultat ist darauf zurückzuführen, dass ausgeschiedene PatientInnen als Nicht-Responder gewertet werden müssen.
Eine weitere Studie über 90 Tage an Osteoarthrose PatientInnen (n = 679: 10) ist durch eine ähnliche Problematik gekennzeichnet: hohe und unterschiedliche (42,4% versus 49,4%) Ausfallsraten und eine hohe Rate an gastrointestinalen Problemen bei Oxycodon in der Eingangstitrationsphase. Nach dieser Phase ist die Rate von Nausea für beide Substanzen praktisch gleich.
In einer Studie mit Osteoarthrose PatientInnen (n = 596: 11) wurden Tapentadol und Oxycodon nicht retardiert und dann für 28 Tage retardiert gegeben und insbesondere der Einfluss auf die Darmtätigkeit untersucht. Auch hier war die Zahl der Studienabbrecher mit 26% versus 53% enorm. Nicht retardiertes Tapentadol mit der Dosis von 75 mg war bezüglich Analgesie non-inferior zu 10 mg Oxycodon, spontane Darmentleerungen pro Woche waren in den ersten 14 Tagen signifikant niederer für Oxycodon (6,8 versus 8,5 für Tapentadol und 9,3 für Placebo), während der 28 Tage war der Unterschied (6,2 versus 7,9) nicht mehr signifikant.
In einer rezenten Studie (13) wurde Tapentadol (100-250 bid) mit Morphin (40 – 100 mg bid) bei Tumorschmerzen verglichen. Aufgrund des Studiendesign (2 Wochen Titration, 4 Wochen Maintenance) war nur für die ersten 2 Wochen ein direkter Wirksamkeitsvergleich möglich, wobei sich eine Non-inferiority für Tapentadol ergab. Allerdings war in der Tapentadol Gruppe eine deutlich höhere Einnahme von rescue medication (Morphin) zu verzeichnen (bei 71,9% versus 58% der PatientInnen, mittlere Tagesdosis 13,65 versus 8,91 mg für Tapentadol versus Morphin) was die Schmerzintensität beeinflusst haben dürfte. Nebenwirkungen waren für beide Substanzen ähnlich, nur in der Titrationsphase (2 Wochen), aber nicht in der nachfolgenden Maintenance Phase waren gastrointestinale Nebenwirkungen (Nausea, Erbrechen, aber nicht Konstipation) in der Tapentadol Gruppe seltener.
Eine Langzeitstudie mit Tapentadol und Oxycodon war open label und lieferte daher keine verlässlichen Daten (12).
Vergleichsstudien wurden nur mit Oxycodon (zwei mit Morphin), aber nicht mit anderen Opioiden, insbesondere auch nicht mit Tramadol, für das eine bessere gastrointestinale Verträglichkeit postuliert wurde (14), durchgeführt.
Grundsätzlich ist zu diesen Studien festzustellen, dass sie alle (4-13) firmenabhängig waren. So sind die Autoren entweder Firmenangestellte und/oder Aktionäre der zuständigen Firma oder von Research Firmen. Nur in 4 Studien (7,8,11,13) ist jeweils nur einer von mehreren Autoren ein Kliniker. Das Vermeiden der zentralen Zulassung und die Art der Durchführung der Studien ohne klare Verantwortung unabhängiger Institutionen entsprechen heute nicht mehr einem guten europäischen Standard.
Zusammenfassend können wir feststellen: Tapentadol (Palexia retard) hat bei entsprechender Dosierung bei Osteoarthrose bzw. Karzinom PatientInnen eine dem Oxycodon bzw. Morphin vergleichbare analgetische Wirkung. Aufgrund methodischer Probleme (hohe Ausfallsraten in den Studien) können genauere wirkungsäquivalente Dosen nicht angegeben werden. Tapentadol hat die für Opioide typischen Nebenwirkungen. Gastrointestinale Probleme (Nausea, Erbrechen, Obstipation) scheinen für Oxycodon bzw. Morphin häufiger zu sein, dieser Unterschied war aber nur in den ersten Tagen der Therapie deutlich und dürfte bei einer vorsichtigen Dosissteigerung dieser Präparate am Beginn der Therapie nicht mehr relevant sein.
Es wurde nicht untersucht, ob Tapentadol gegenüber Tramadol der gleichen Firma und mit dem gleichen Wirkungsmechanismus Vorteile besitzt. Beide Substanzen können das seltene aber schwere Serotoninsyndrom (siehe Pharmainfo XXIII/2/2008) auslösen. Bei Tramadol kann es zu Krampfanfällen kommen, dies ist auch für Tapentadol nicht auszuschließen (siehe Fachinformation). Aufgrund der Datenlage (limitierte Qualität der Studien und problematisches Design) ist das teurere Tapentadol bestenfalls als Reservemittel zu betrachten, wenn Tramadol und andere Opioide, die auch als Generika zur Verfügung stehen, sich als unverträglich erweisen.
Literatur:
(1) Dtsch Apoth Z 36,4434,2010
(2) J Pain Res 4,211,2011
(3) J Pharm Exp Ther 323,265,2007
(4) Anaesth Analg 107,2048,2008
(5) Curr Med Res Op 25,785,2009
(6) Curr Med Res Op 425,1551,2009
(7) Clin Ther 31,260,2009
(8) Clin Drug Invest 30,489,2010
(9) J Op Man 6,169,2010
(9a) Exp Opin Pharmacother 11,1787,2010
(10) Curr Med Res Op 25,1095,2009
(11) Adv Ther 28,401,2011
(12) Pain Pract 10,416,2010
(13) Pain Phys 17,329,2014
(14) Clin Pharmacokin 43,879,2004
Veränderung von Verschreibungszahlen für umstrittene Präparate
Wir haben im Laufe der letzten Jahre für mehrere Präparate einen nicht klar belegten Nutzen bzw. höhere Risiken diskutiert. Es dürfte interessant sein, Veränderungen in den Verschreibungszahlen für diese Präparate zu betrachten. Dies ist möglich für Deutschland, für das jedes Jahr der Arzneiverordnungs-Report (Hrsg. U. Schwabe, D. Paffrath: Ausgabe 2014 mit Daten für 2013) diese Zahlen und ihre Veränderungen publiziert. Für Österreich gibt es keine vergleichbaren publizierten Daten.
Aliskiren (Rasilez)
Für diesen Blutdrucksenker aus der Gruppe der Renin-Angiotensin-System-Blocker stellten wir fest, dass keine Endpunktstudien vorliegen bzw. dass es bereits Hinweise auf negative Auswirkungen gibt (Pharmainfo XXIII/2/2008; XXVII/4/2012). Im Jahre 2013 sank die Verschreibung von Rasilez um 27%. Die anderen RAS-Blocker wurden 50mal mehr verschrieben.
Omega-3-Fettsäuren (Corbene, Omacor)
Wir haben berichtet (Pharmainfo XXVI/1/2011; XXVII/4/2012), dass die Gabe von diesen ungesättigten Fettsäuren nach rezenten Studien die kardiovaskuläre Mortalität nicht zu senken vermag. Die Verschreibung dieses Präparats sank um 14%.
Pioglitazon (Generika, Actos)
Für dieses Diabetesmittel sahen wir (Pharmainfo XXVI/3/2011; Pharmainfo XXVII/4/2012) wegen der Nebenwirkungen (Herzinsuffizienz, Knochenbrüche, Blasenkarzinom) und einer nicht durch Endpunktstudien sicher belegten Wirkung auf kardiovaskuläre Parameter ein negatives Nutzen/Risiko-Verhältnis.
2013 sank die Verschreibung von einem bereits niedrigen Niveau (Sulfonylharnstoffe: 150mal mehr) um 30,7%.
Ginkgo (Cerebokan, Ceremin, Tebofortan)
Die Wirkung dieser Präparate bei Tinnitus, kognitiven Störungen und Prävention und Therapie von Alzheimer ist nicht ausreichend belegt (Pharmainfo XXIV/1/2009; XXVII/4/2012). Die Verschreibung in Deutschland ist seit Jahren rückläufig, 2013 sank sie um 1,7% (im Vergleich: Cholinesterasehemmer und NMDA-Rezeptorantagonisten wie Memantin: Generika, Axura, Ebixa), die 10mal häufiger verschrieben wurden, stiegen um 26,7%).
Drospirenon-haltige Kontrazeptiva (Aliane, Balancette, Cleodette, Cleonita, Cleosensa, Danselle, Danseo, Daylina, Drosiane, Eloine, Volina, Yasmin, Yasminelle, Yaz, Yirala)
Wir haben von diesen Kontrazeptiva mehrfach berichtet (Pharmainfo XXIX/1/2014; XXVII/4/2012; XXVI/3/2011; XVII/4/2002). Gegenüber Präparaten der 2. Generation (z.B. Levonorgestrel: zahlreiche Präparate) haben diese Kontrazeptiva ein ca. 2fach erhöhtes Thromboserisiko und stellen daher kein Mittel erster Wahl dar. 2013 sank die Verschreibung um 29,5% (andere Einphasenpräparate wurden 10mal häufiger verschrieben).
Dipyridamol plus Acetylsalicylsäure (Asasantin)
Für dieses Präparat zur Sekundärprävention haben wir festgestellt (Pharmainfo XXVIII/3/2013; XXVI/2/2011), dass die Monosubstanz Acetylsalicylsäure (Generika) vergleichbar, wenn nicht besser wirkt und mit weniger Nebenwirkungen belastet ist. Die Verschreibung hat 2013 um 8,5% abgenommen, Acetylsalicylsäure wurde 20mal mehr verschrieben.
Dronedaron (Multaq)
Für dieses Mittel zur Prävention und Behandlung von Vorhofflimmern haben wir berichtet (Pharmainfo XXV/2/2010; XXVI/4/2011), dass es schwächer als Amiodaron (Generika, Sedacoron) wirkt, von den Nebenwirkungen her aber keine entscheidenden Vorteile bietet (bei PatientInnen mit Herzinsuffizienz und persistierendem Vorhofflimmern zeigte sich sogar eine erhöhte Mortalität).
Die Verschreibung ist 2013 von einem niederen Niveau (Amiodaron 6mal mehr) um 4% abgesunken.
Ivabradin (Procoralan)
Für diese Substanz stieg die Verschreibung um 24%. Dies dürfte durch die neu hinzugekommene Indikation bei Herzinsuffizienz bei einer trotz Betablockertherapie bestehenden Herzfrequenz über 75/min bedingt sein. Zu dieser Indikation haben wir festgestellt (Pharmainfo XXVIII/1/2013), dass sie nur für wenige PatientInnen, bei denen eine maximal verträgliche Betablockertherapie die Frequenz nicht ausreichend senkt, in Erwägung zu ziehen ist. Für die zweite Indikation, i.e. chronische Angina pectoris, mussten wir feststellen, dass die bisher vorliegenden kardiovaskulären Endpunktstudien insbesondere für Mortalität keinen positiven Effekt zeigten. Inzwischen wurde die Signify Studie (1) publiziert, die aufgrund teilweise negativer Daten zu einem Referral bei der EMA in London führte. In dieser Studie wurden PatientInnen mit stabiler Koronarerkrankung und einer Herzfrequenz von über 70 zusätzlich zu einer Basistherapie (83% erhielten Betablocker) mit Ivabradin behandelt. Nach einer medianen Nachbehandlung von 27,8 Monaten war für den Primärparameter kardiovaskuläre Mortalität und nicht-tödlicher Herzinfarkt kein Unterschied (6,8 versus 6,4%) festzustellen. In einer großen Subgruppe mit schwerer symptomatischer Angina (12.049 von insgesamt 19.102 PatientInnen) war dieser Primärparameter sogar signifikant erhöht (RR = 1,18; 95% Konfidenzintervall 1,03 – 1,35), auch die Frequenz von Vorhofflimmern (5,3 versus 3,8%) war angestiegen. Aufgrund dieser Daten haben die EMA-Komitees PRAC und CHMP in London (21/11/2014) folgende Maßnahmen beschlossen. Ivabradin soll nur bei PatientInnen mit Angina pectoris, die trotz Betablockertherapie (oder bei deren Kontraindikation) eine Pulsfrequenz von über 70 haben, verwendet werden. Wenn sich innerhalb von 3 Monaten die Symptome nicht deutlich bessern, soll das Mittel abgesetzt werden. Wenn eine Bradykardie unter 50 trotz Dosisreduktion auftritt, ist die Therapie ebenfalls zu beenden. Eine laufende Kontrolle des Auftretens von Vorhofflimmern wird empfohlen.
Wenn man dies zusammenfasst, ist bei Angina pectoris Ivabradin wohl nur mehr in Einzelfällen eine vertretbare Therapie.
Roflumilast (Daxas)
Für diese Substanz haben wir berichtet (Pharmainfo XXVI/4/2011; XXVII/2/2012; XXVIII/3/2013), dass zwar bei COPD positive Effekte erhalten werden, diese aber von fraglicher klinischer Relevanz sind. Demgegenüber stehen Nebenwirkungen, wie Diarrhoe, Gewichtsverlust und möglicherweise Suizidrisiko (siehe auch 2). Insbesondere fehlen Studien, die eine Wirkung bei Zugabe zur Kombinationstherapie Bronchialerweiterer/inhalatives Cortison belegen bzw. eine vergleichbare Wirkung zu Cortison demonstrieren. Für diese Frage wurden bei der Zulassung postmarketing-Studien auferlegt und zumindest eine Studie (REACT) sollte heuer zu Ende gehen. Dann wird sich zeigen, ob diesem Präparat ein definierter Platz in der Therapie zukommt.
Im Jahre 2013 stieg die Verschreibung zwar um 10%, aber auf einem weiterhin niedrigen Niveau (inhalatives Cortison: 60mal mehr).
Ezetimib (Ezetrol; zusammen mit Simvastatin: Inegy)
Für Ezetimib ist zwar eine Cholesterinsenkung belegt, aber es lagen keine Daten vor, die so wie für Statine eine Senkung der kardiovaskulären Mortalität feststellten. Eine Zugabe zu Simvastatin führte zwar zu einer verstärkten Senkung des Cholesterinspiegels, aber zu keiner Reduktion der Intima-Media-Dicke der Carotis, ein Parameter für Atherosklerosefortschritt (Pharmainfo XXIII/4/2008). Der Nutzen dieser Medikamente wurde daher kontrovers beurteilt. Die Verschreibung ging 2013 um 11,7% zurück (Statine wurden 20mal häufiger verschrieben).
Zehn (!) Jahre nach der Zulassung wurde nun eine Studie (Improve – it) mit kardiovaskulären Endpunkten abgeschlossen (Studienplan: 3; Studienresultate noch nicht im Detail veröffentlicht: siehe 3a). PatientInnen nach einem akuten Koronarsyndrom und einem Ausgangs LDL-Cholesterinspiegel unter 125 mg/dl erhielten entweder Simvastatin (40 mg) bzw. Simvastatin (40 mg) + Ezetimib (10 mg). Im Verlauf von 7 Jahren betrugen die LDL-Cholesterin-Spiegel 69 mg/dl versus 54 mg/dl. Der Primärparameter (CV-Mortalität, nicht-tödlicher Herzinfarkt und Schlaganfall, Hospitalisierung wegen instabiler Angina und koronarer Revascularisation) sank in der Ezetimib-Gruppe von 34,7 auf 32,7% (also um 6%, NNT = 50). Die kardiovaskuläre Mortalität blieb aber unverändert.
Ezetimib zeigte also eine gewisse, aber nur eine geringe Verhinderung von Herzinfarkten und Schlaganfällen, aber keine auf den entscheidenden Parameter Mortalität. Diese Resultate sind vor allem dann enttäuschend, wenn wir sie mit denen von Statinen in steigenden Dosen vergleichen, wie sie in einer Metaanalyse von 26 Studien mit 39.612 TeilnehmerInnen errechnet wurden (4). Intensive Statintherapie (stärker wirksame mit höheren Dosen) führte bei einer LDL-Senkung um 20 mg/dl gegenüber weniger intensiven Therapien zu einer Erniedrigung von „major cardiovascular events“ um 15% und von kardiovaskulärer Mortalität um 7%. Analoge Resultate wurden auch bei PatientInnen erhalten, deren LDL-Ausgangswert bereits niedrig war (70 mg/dl). Offensichtlich ist bei intensiverer Statintherapie und dadurch stärkerer Senkung der LDL-Werte eine zusätzliche Senkung der kardiovaskulären Ereignisse gegeben (siehe z.B. auch 5), und dies betrifft auch die kardiovaskuläre Mortalität (siehe 6,7). Ezetimib-Zugabe zeigte hingegen trotz einer zusätzlichen Senkung des LDL-Cholesterins um 15 mg/dl nur eine 6%ige Reduktion der kardiovaskulären Ereignisse und keinen Effekt auf die Mortalität.
Eine rezente Studie (allerdings nur eine Beobachtungsstudie) mit 9.597 PatientInnen (8) verglich die Wirkung von Simvastatin und Simvastatin + Ezetimib mit der stark wirksamer Statine, wie Atorvastatin und Rosuvastatin. Diese Letzteren führten nach 3 Jahren zu einer deutlich reduzierten Mortalität (HR 0,72; 95% Cl 0,59 – 0,88) verglichen mit Simvastatin, aber auch mit Simvastatin plus Ezetimib.
Was ergeben sich daraus für Konsequenzen?
Für die Kombination Ezetimib mit Simvastatin (Inegy) gibt es keinen Platz mehr in der Therapie der Hypercholesterinämie. Wenn Simvastatin (40 mg: Generika, Zocord) den Cholesterinspiegel nicht ausreichend senkt (80 mg sind wegen eines erhöhten Rhabdomyolyse-Risikos nicht mehr zu verwenden: siehe Pharmainfo XXVI/2/2011), dann ist ein Umsteigen auf stark wirksame Statine, und zwar Rosuvastatin (Crestor) bzw. vor allem das preisgünstigere und besser untersuchte Atorvastatin (Generika, Sortis) zweckmäßig, da diese kardiovaskuläre Endpunkte besser als Ezetimib verhindern und zusätzlich sogar die Mortalität senken. Führen diese Präparate nicht zu einer ausreichenden Senkung des Cholesterinspiegels, kann nur dann die Gabe von Ezetimib (Ezetrol) in Erwägung gezogen werden. Sollte diese Zugabe dieser Substanz aber nicht eine deutliche weitere Senkung von Cholesterin bewirken, ist diese Substanz abzusetzen.
Generelle Zusammenfassung:
Als wesentliches Ergebnis dieser Diskussion sehen wir die Tatsache, dass der/die verschreibende Arzt/Ärztin über zweifelhafte Nutzen/Risiko-Verhältnisse offensichtlich Bescheid wissen und Konsequenzen daraus ziehen. Es ist abzusehen, dass Präparate, die kaum mehr verschrieben werden, letztlich vom Markt genommen werden. Bei den meisten hier diskutierten Präparaten ist nicht zu erwarten, dass weitere Studien, wenn sie überhaupt durchgeführt werden, diese Bewertung verändern können. Für Ezetimib hat die gerade publik gewordene Improve-it Studie zu keinem überzeugend positiven Resultat geführt, für Roflumilast wird sich bald zeigen, ob dies gelingt.
Literatur:
(1) NEJM 371,1091,2014
(2) Thorax 69,616,2014
(3) Am Heart J 168,205,2014
(3a) DAZ 154,5182,2014
(4) Lancet 376,1670,2010
(5) NEJM 352,1425,2005
(6) NEJM 350,1495,2004
(7) Lancet 366,267,2005
P.b.b. Erscheinungsort Verlagspostamt 1010 Wien
Montag, 23. Februar 2015
Pharmainformation
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.



