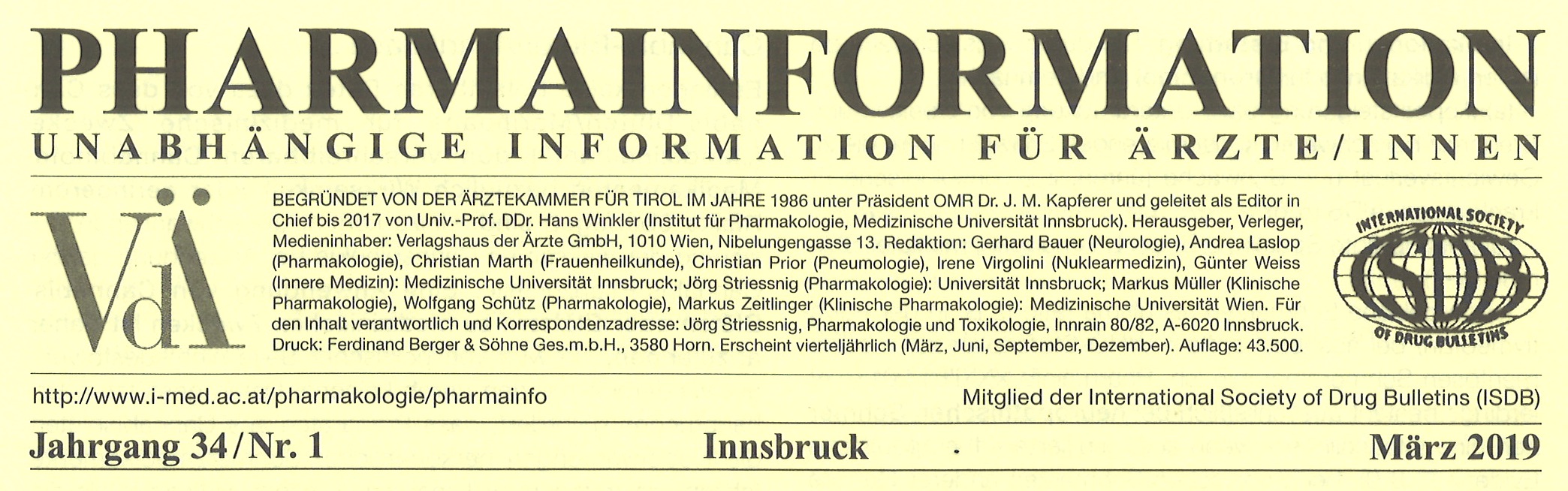
Inhalt
- Cannabisprodukte in der Medizin
- Omega-3 Fettsäuren (OMACOR)
- Zur Inzidenz von Nebenwirkungen
- Diclofenac: weitere Daten zum Risiko
- Calcitonin gene-related peptide (CGRP) - gerichtete therapeutische Antikörper zur Migräneprävention
Cannabisprodukte in der Medizin
Cannabinoide sind die Inhaltstoffe der Hanfpflanze (Cannabis sativa). Als psychoaktiv wirksam wurde D9-Tetrahydrocannabinol (THC) identifiziert, das auch die Entdeckung und Klonierung zweier Cannabinoidrezeptor-Subtypen ermöglichte (CB1‑ und CB2‑Rezeptoren). Endogene Cannabinoide im Gehirn fungieren über CB1-Rezeptoren als neuromodulatorische Lipide. Haschisch nennt man das gepresste Harz aus den Spitzen der blühenden Hanfstaude, als Marihuana wird ein tabakartiges Gemisch aus den getrockneten Blättern und Blüten bezeichnet. Die Einnahme, sei es inhalativ oder – als Haschischöl – oral, erzeugt als angenehm empfundene Halluzinationen ("high"-Gefühl) und Entspanntheit ("mellowing out"). Aufmerksamkeit, Reaktionszeit, Lernen und Gedächtnis sind eingeschränkt. Das Risiko, eine Abhängigkeit zu entwickeln, liegt mit etwa 9% im Bereich der Benzodiazepin-Anxiolytika (1); zum Vergleich: für Nikotin beträgt das Risiko 67,5%, für Alkohol 22,7% (2). Umgekehrt sind für THC auch medizinisch erwünschte Effekte beschrieben: Stimulierung des Appetits bei AIDS-PatientInnen, Reduktion epileptischer Anfälle, Unterdrückung von Nausea bei Chemotherapie, Schmerzlinderung und Senkung des intraokulären Druckes bei Glaukom. Dieser weite Bereich an medizinisch erwünschten Effekten, verbunden mit der Einstufung von THC-haltigen Hanfzubereitungen als bloß "milde" Suchtmittel (damit unter Missachtung möglicher hirnorganischer Langzeitschäden), hat zu einem wahren "Hype" sowohl für die Einnahme von Cannabisprodukten und (verbotenem) "indoor growing" von Hanf geführt als auch zum Kauf Hanfsamen-haltiger Lebensmittel und Kosmetika (für die ein THC-Grenzwert von 0.3% gilt). Letzteres wurden in Österreich mittels eines Erlasses des Gesundheitsministeriums untersagt (3). Umgekehrt dürfen Cannabis-Blüten und ‑Blätter in 13 US-Bundesstaaten und in Kanada legal verkauft werden.
Die öffentliche Sichtbarkeit von Cannabisprodukten steht jedenfalls im krassen Gegensatz zu deren wissenschaftlicher Evidenz bezüglich Wirksamkeit und Risiko in der medizinischen Anwendung. Medizinische eingesetzte Cannabinoide sind THC (internationaler Freiname: Dronabinol) und das nicht psychotrop wirkende Cannabidiol. Die dazu verfügbaren wissenschaftlichen Daten und deren daraus ableitbare therapeutische Relevanz werden im Folgenden bewertet.
Medizinische verfügbare Cannabinoide
Dronabinol-hältige Zubereitungen unterliegen der Suchtgiftverordnung. Einerseits kann Dronabinol in Form von Tropfen oder Kapseln in Apotheken magistraliterzubereitet werden und ist dabei bewilligungspflichtig gemäß Arzneitaxe (was einer Zuordnung zum Gelben Bereich des Erstattungskodex entspricht). Andererseits gibt es Dronabinol in Kombination mit Cannabidiol als Arzneispezialität (Sativex-Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, ein pflanzliches Extakt aus zwei speziell gezüchteten Cannabis sativa-Spezies mit reproduzierbarer Zusammensetzung von Dronabinol und Cannabidiol); als vollsynthetisches THC-Analog ist Nabilon (Canemes-Kapseln) verfügbar. Beide Arzneispezialitäten sind nicht im Erstattungskodex enthalten, die Kosten werden in begründeten Einzelfällen aber von der Kasse übernommen (s.u.). Eine magistrale Zubereitung von Cannabidiol-Tropfen oder ‑Kapseln ist rezeptfrei möglich.
Wissenschaftliche Daten zur Wirksamkeit: Der medizinische Einsatz von Cannabinoiden ist keinesfalls durch wissenschaftliche Daten ausreichend belegt, wobei in den Studien vor allem THC, dessen Analoga oder die Kombination THC plus Cannabidiol untersucht wurden. Trotz vieler randomisierter kontrollierter Studien zu einer Vielzahl von Krankheiten waren die Methodik zumeist mangelhaft, die PatientInnenzahl zu klein und die Studiendauer kurz, sodass die Ergebnisse nur eingeschränkte Aussagekraft besitzen. Es sei auch darauf verwiesen, dass die euphorisierende Wirkung von THC von ProbandInnen in Doppelblindstudien subjektiv ("being high") wahrgenommen wird, damit eine Verblindung erschwert und die tatsächliche Wirkung von THC überschätzt wird (4). Aus einer Vielzahl von Metaanalysen mit oft unterschiedlicher Einschätzung des möglichen PatientInnennutzens in unterschiedlichen Indikationen (5-7) kann eine moderate bis niedrige Evidenz für die Wirksamkeit vor allem für THC/Dronabinol-haltige Anwendungen in den Indikationen chronische neuropathische Schmerzen, Chemotherapie-induzierte Übelkeit und Erbrechen sowie Spastizität bei multipler Sklerose angenommen werden, ohne dass allerdings eine Überlegenheit oder ein geringeres Risiko gegenüber anderen in diesen Indikationen verfügbaren Medikamenten belegt ist. Zweifelhaft ist die Evidenz hingegen für eine kurzzeitige schlafverbessernde Wirkung bei mit chronischen Schmerzen einhergehenden Erkrankungen und bei multipler Sklerose, ebenso für eine Gewichtszunahme im Rahmen von AIDS, für die Anwendung bei Tourette-Syndrom sowie bei Angstzuständen (5-10).
Cannabidiol wirkt im Gegensatz zu THC nicht psychotrop und soll entkrampfend, entzündungshemmend, angstlösend und gegen Übelkeit wirken und die psychotrope und tachykarde Wirkung von THC abschwächen (11).
Mangelhaft ist die Datenlage für eine Unwirksamkeit der Cannabinoide (6,7), wie bei Demenz, Glaukom, Depression, Anorexia nervosa, Reizdarmsyndrom, Epilepsien (exklusive Dravet- und Lennox-Gastaut-Syndrom, s.u.) sowie Morbus Parkinson.
Indikationen und Erstattung: Die durchwegs schwach belegten Indikationen für Dronabinol sind demnach: (a) Appetitsteigerung bzw. Unterdrückung von Übelkeit und Brechreiz bei schweren konsumierenden Erkrankungen, die zu Gewichtsverlust und Schwäche führen, z.B. onkologische Erkrankungen, AIDS (5,6); (b) ausgeprägte Spastik, z.B. bei Lähmungen, multipler Sklerose (5-7); (c) chronische Schmerzen als ultima ratio(z.B. in der Palliativmedizin) bei ausgeschöpftem WHO-Stufenplan zur medikamentösen Schmerztherapie (sh. Pharmainfo XXXIII/1/2018). Allerdings besteht ausschließlich bei neuropathischen Schmerzen eine tatsächliche – wenn auch limitierte – therapeutische Evidenz (6,8,9), bei chronischen Schmerzen anderer Genese ist ein Nutzen von Cannabis-Präparaten nicht nachgewiesen und sie sind auch nicht in der Lage, einen Opioid-Verbrauch zu reduzieren (12).
Für Cannabidiol ist die Datenlage bezüglich Wirksamkeit und Sicherheit ebenso mangelhaft. Wie bei THC erfolgt daher aktuell keine generelle Kostenerstattung durch die Krankenversicherung. Ausnahme sind die speziellen kindlichen Epilepsieformen Dravet- und Lennox-Gastaut-Syndrom (beides Orphan-Diseases; 13,14). Hier ist demnächst eine gesamteuropäische Zulassung von Epidiolex 100mg/ml orale Lösung zu erwarten, einer Arzneispezialität mit dem Wirkstoff Cannabidiol, als Zusatz zur antiepileptischen Standard-Therapie dieser Erkrankungen. In den USA ist es als Orphan-Drug seit Juni 2018 zugelassen.
Die Kombination aus THC und Cannabidiol (Sativex) ist lt. Fachinformation nur in der Indikation "zur Symptomverbesserung bei erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Spastik aufgrund von multipler Sklerose (MS), die nicht angemessen auf andere anti-spastische Medikamente angesprochen haben" zugelassen. Die Wirkung der Kombination ist allerdings schlecht belegt (5,15,16) und laut früherer Bewertung (Pharmainfo XXVIII/3/2013) "gering und das nur bei einem Teil der PatientInnen". Auf Grund der beschränkten Wirksamkeit wurde folgender Satz in die Fachinformation von Sativex aufgenommen: Falls keine klinisch signifikante Verbesserung von mit der Spastik in Verbindung stehenden Symptomen während dieses Anfangstherapieversuchs (Anm.: nach 4 Wochen) beobachtet wird, sollte die Behandlung beendet werden.
Nabilon (Canemes), ein vollsynthetisches THC-Analogon, ist lt. Fachinformation zur "Behandlung von Chemotherapie-bedingter Emesis und Nausea bei jenen Krebs-Patienten, die auf andere antiemetische Behandlungen nicht adäquat ansprechen“ zugelassen, und ebenfalls nicht im Erstattungskodex. Die bescheidene Datenlage weist auf keine therapeutische Evidenz weder für dieser Indikation hin (17) noch für die Schmerztherapie bei KrebspatientInnen.
Nebenwirkungen der Cannabinoide
THC: Relevante Nebenwirkungen sind kognitive Beeinträchtigung und psychische Effekte wie Euphorie oder Halluzinationen, Vertigo, Mundtrockenheit, sowie vegetative Effekte (8,12). Entsprechend dem belegten Suchtpotential von THC kann es zu Toleranzentwicklung und Entzugserscheinungen (Angst, Schlaf- und Appetitstörungen, Diarrhöe) sowie zum Triggern von Psychosen und Angststörungen kommen. In der Literatur werden ebenfalls negative Effekte auf die Hirnentwicklung beschrieben (18). Neuroimaging-Studien belegen zunehmend nicht-reversible Veränderungen der Hirnstruktur (z.B. Dicke von kortikalen Arealen) nach langdauerndem Cannabis-Konsum im Jugendalter (19).
Cannabidiol: Die in Studien beobachteten Nebenwirkungen waren Sedierung, Lethargie, verminderter Appetit, Übelkeit, Durchfall, Schlafstörungen und erhöhte Leberenzyme (13).
Cannabis-Blüten/Marihuana
Es liegen keine belastbaren Daten dazu vor, dass Cannabis-Blüten/Marihuana für medizinische Zwecke („Medizinalhanf“) den verschreibbaren Cannabinoid-Medikamenten bezüglich Wirksamkeit oder geringerem Risiko überlegen sind. Hinzu kommt die schwankende Dosierung der wirksamen Cannabinoide bei Einnahme ganzer Cannabis-Pflanzenteile. Eine Anwendung von Cannabis-Blüten oder ‑Blättern zu medizinischen Zwecken ist daher abzulehnen, sie wird von politischer Seite nichtsdestoweniger wiederholt mit den durch keinerlei Daten gestützten Behauptungen gefordert, dass Präparaten aus Cannabisblüten die Nebenwirkungen herkömmlicher Schmerzmedikamente fehlten, sie trotzdem wirksam seien, sogar wirksamer als die Einzelsubstanz THC, da sie zahlreiche weitere zusammenwirkende Inhaltstoffe enthielten, und sie keine Sucht auslösten. Eine rezente (und einstimmige) Forderung auf Zulassung von Medizinalhanf stammt vom Gesundheitsausschuss des Nationalrats (20). Über die von Fachgremien daraufhin geäußerte Ablehnung reagierten Teile der hiesigen Politik „enttäuscht“ und verwiesen auf jene Länder, deren Gesundheitsbehörden dem politischen Druck bereits nachgegeben hatten (21), dazu zählen u.a. Deutschland, Spanien und die Niederlande.
Pädiatrische PatientInnen
Bei Einnahme von THC während der Schwangerschaft besteht die Gefahr einer schädigenden Einwirkung auf die Gehirnentwicklung (18). Bei Verordnung von THC für Schwangere ist dieser Umstand zu berücksichtigen. Bei Kindern ist die Verabreichung kontraindiziert. Sativex und Canemes sind nur für Erwachsene zugelassen.
Missbrauch
Es besteht ein Abhängigkeitspotential für THC und dessen Analoga. Aus diesem Grund sind Verordnungen dieser Wirkstoffe für PatientInnen mit Suchterkrankungen kontraindiziert. Die gleichzeitige Verordnung von Morphinen zur Substitutionstherapie bei Opioidabhängigkeit und Dronabinol ist unbedingt zu vermeiden und ein Missbrauch zu verhindern.
Literatur
(1) Anthony JC et al, Exp Clin Psychopharmacol 2, 244, 1994
(2) Lopez-Quintero C et al, Drug Alc Dep 115, 120, 2011
(3) Erlass des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
(BMASGK) vom 18.10.2018
(4) Wilsey et al, Cannabis Cannabinoid Res 1, 139, 2016
(5) Whiting P et al, JAMA 313, 2456, 2015
(6) The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids, The National Academies Press,
Washington D.C., 2017
(7) Glaeske G, Sauer K, Cannabis-Report, Universität Bremen, 2018
(8) Nugent SM et al, Ann Int Med 167, 319, 2017
(9) Andreae MH et al, J Pain 16, 1221, 2017
(10) Aviram J, Samuelly-Leichttag G, Pain Physician 20, E755, 2017
(11) Mechoulam R et al, Chemistry & Biodiversity 4, 1678, 2007
(12) Campbell G et al, Lancet Public Health 3, e341, 2018
(13) Devinsky O et al, N Engl J Med 376, 2011, 2017
(14) Devinsky O et al, N Engl J Med 378, 1888, 2018
(15) Wade D et al, Multiple Sclerosis 16, 707, 2010
(16) Langford RM et al, J Neurol 260, 984, 2013
(17) J et al, Cancer Chemother Pharmacol 79, 467, 2017
(18) Tortoriello G et al, EMBO Journal 33, 668, 2014
(19) AC et al, Cannabis Cannabinoid Res 10, 242, 2018
(20) Nationalrat, Bericht des Gesundheitsausschusses vom 19.6.2018
(21) https://derstandard.at/2000095056036/Medizinalhanf-bleibt-auch-in-Zukunft-verboten
Omega-3 Fettsäuren (OMACOR)
Omacor (Eicosapentaensäure-Ethylester: EPA und Decosahexaensäure: DHA ) ist zur Behandlung von Hypertriglyzeridämie und zur unterstützenden Behandlung im Rahmen der Sekundärprophylaxe nach Myokardinfarkt (zusätzlich zur Standardtherapie) zugelassen.
Zu letzterer Indikation: Da sich eine Ernährung reich an Fischmahlzeiten positiv auf Gesundheit und Lebenserwartung auswirkt, hat man sich von der Zufuhr von mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die insbesondere in fetten Fischen enthalten sind, positive Effekte versprochen. Tatsächlich hat eine erste große Studie (GISSI; siehe Pharmainfo XIX/2/2004) bei PatientInnen nach Herzinfarkt eine zwar geringe, aber signifikante Senkung der kardiovaskulären Komplikationen durch Zufuhr von Omega-3 Fettsäuren erbracht. Nachfolgende Studien konnten dies nicht bestätigen (siehe Pharmainfo. XXVI/1/2011), und wir haben bereits 2012 (Pharmainfo XXVII/ 4/2012) über zwei Metaanalysen berichtet, die für die Sekundärprophylaxe nach Herzinfarkt keine Hinweise für positive Effekte ergaben.
Im Jahre 2018/19 sind nun mehrere relevante Publikationen erschienen. Eine Metaanalyse (1) von 10 Studien mit 77.917 Personen ergab für die Gabe von Omega-3 Fettsäuren (in 9 von 10 Studien EPA und DHA bis 1800 mg pro Tag) keinen Effekt in Bezug auf kardiovaskuläre Endpunkte. Dies gilt sowohl für die Untergruppe mit vorhergehender Koronarerkrankung als auch für PrimärprophylaxepatientInnen. Ein Cochrane Review (2) evaluierte 79 Studien (62 davon mit Omega-3 Fettsäure-Kapseln) mit 112.059 Personen. Die Schlussfolgerung war: “There is no evidence that taking omega-3 capsules reduces heart disease, stroke or death”. Leider wurden die Studien nicht bezüglich der Höhe der Dosis bewertet.
Zwei kürzlich publizierte Studien, die in den Metaanalysen nicht enthalten waren, seien noch diskutiert. In einer Studie (3) erhielten DiabetespatientInnen (n = 15.480) ein Gramm Omega-3 Fettsäuren (EPA und DHA) über 7,4 Jahre. Es kam zu keiner Verbesserung der kardiovaskulären Endpunkte. In einer weiteren Studie (3a) wurden 25.871 Personen ohne kardiovaskuläre Vorerkrankung über 5,3 Jahre mit einem Gramm (EPA und DHA) behandelt. Es zeigte sich kein Effekt (HR 0,92; 0,8-1,06) auf die Inzidenz von Myokardinfarkt, Schlaganfall und die kardiovaskuläre Mortalität.
Die Schlussfolgerung für all diese Daten ist, dass weder für die Primär- noch für die Sekundärprophylaxe Omega-3 Fettsäuren (EPA- und DHA-Gemisch) bis zu einer Dosis von 1800 mg positive Effekte auf kardiovaskuläre Endpunkte haben.
Jetzt hat auch die europäische Zulassungsbehörde festgestellt, dass die Indikation: Sekundärprophylaxe nach Herzinfarkt keine Berechtigung mehr hat (EMA, 14/12/2018, EMA/712678/2018: Omega-3 fatty acid medicines), weshalb diese Indikation für Omacor zu streichen ist. Da die Firmen gegen diese Bewertung berufen haben, soll die endgültige Entscheidung erst voraussichtlich Ende März 2019 erfolgen (sh. Update 01/02/2019, EMA/712678/2018).
Eine in der Zwischenzeit publizierte Studie (3b) könnte einen neuen Aspekt relevant machen (allerdings eine Firmenstudie mit Beteiligung von Firmenangehörigen als AutorInnen). Darin wurden 8.179 PatientInnen (70,7% als Sekundärprophylaxe) mit hohem Triglyzeridspiegel über 4,9 Jahre mit 4,0 Gramm Icosapent-Ethylester („highly purified and stable EPA“: 3b) behandelt. Es kam zu einer deutlichen und signifikanten Senkung (HR 0,75; 0,68-0,83) des kombinierten Primärparameters (kardiovaskuläre Mortalität, Herzinfarkt, Schlaganfall, koronare Revaskularisation und instabile Angina), wobei auch die einzelnen Komponenten signifikant gesenkt wurden. Warum steht diese Studie in offensichtlichem Widerspruch zu den oben diskutierten Daten? Drei Möglichkeiten seien besprochen. Diese Studie (i) verwendete nur EPA und kein Gemisch von Fettsäuren und (ii) diese in einer deutlich höheren Dosis von 4 Gramm (doppelt bis 4-fach zu den oben beschriebenen Studien). (iii) Als Placebo wurde Mineralöl verwendet, was zu einer veränderten Resorption von Pharmaka (wie z.B.Statinen) führen könnte (siehe 3c). Tatsächlich stieg in der Placebogruppe das LDL-Cholesterol um 10,2%, in der Verumgruppe nur um 3,1% (leider nur nach einem Jahr bestimmt). Dies könnte die kardiovaskulären Endpunkte für die Placebogruppe relativ zur Verumgruppe verschlechtern. Das Ausmaß der Senkung der bei diesen PatientInnen hohen Triglyceridspiegel korrelierte nicht mit den positiven Daten und kann diese daher nicht erklären. Erst weitere Studien können klären, ob diese vom Gesamtbild völlig abweichenden Daten in diesem PatientInnenkollektiv bestätigt werden können.
Nicht nur für Herz-Kreislauferkrankungen, sondern auch für weitere gesund- heitliche Beeinträchtigungen erhoffte man sich positive Effekte von Omega-3 Fettsäuren. Mehrere rezente (2018) Studien führten zu relativ klaren Resultaten.
Nachlassen der kognitiven Fähigkeiten und Alzheimer-Demenz
Für ersteres fanden zwei große Studien (4,5) keinen positiven Effekt in Bestätigung einer früheren Metaanalyse (6). Eine Metaanalyse für Alzheimer-PatientInnen (Cochrane: 7) kam zu folgender Schlussfolgerung: „We found no evidence of benefit or harm in mild or moderate Alzheimer“.
Depression bei Jugendlichen und Erwachsenen
Drei Studien, zwei aus den USA (8,9) eine aus dem Iran (10) inkludierten nur kleine PatientInnenzahlen und erbrachten keine eindeutigen Resultate. Dementsprechend spricht eine rezente Metaanalyse (11) von „mixed findings“ and „more high-quality studies are needed“.
Karzinome
Eine große (25.871 Personen) Studie über 5,3 Jahre zeigte keinen Effekt (HR 1,03) auf die Inzidenz invasiver Karzinome (12). In PatientInnen mit einem hohen Colonkarzinomrisiko senkte die Gabe von Omega-3 Fettsäuren nicht die Zahl der PatientInnen mit zumindest einem Adenom (13).
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Ein Cochrane Review aus dem Jahre 2012 fand nach einer Metaanalyse von 13 randomisierten Studien „little evidence that omega-3 fatty acid supplementation is beneficial“ (14). Eine rezente Metaanalyse von 7 Studien fand eine Verbesserung der klinischen Symptome (15). Eigenartigerweise fanden sich nur 2 Studien gemeinsam in beiden Metaanalysen. Ein consensus panel kam daher zum Schluss: „further high quality research is needed“ (16).
Schwangerschaft und Frühgeburten
Ein großer (70 randomisierte Studien mit 19.927 Frauen) Cochrane Review (17) fand für Frühgeburten vor der 37. Woche eine Reduktion von 13,4% auf 11,9% (RR = 0,89; 0,81-0,97; NNT von 68) und für Frühgeburten vor der 34. Woche eine Reduktion von 4,6% auf 2,7% (RR = 0,58; 0,44-0,77; NNT: 52). Numerisch erhöht waren Schwangerschaftsdauer über 42 Wochen (1,6% auf 2,6%), numerisch gesenkt waren die perinatale Mortalität (RR = 0,75; 0,54-1,03) und Einweisungen auf neonatale Intensivstationen (RR = 0,92; 0,83-1,03). Für mehrere andere Parameter für Mütter (z.B. postnatale Depression, Schwangerschaftsdiabetes) und Kind (z.B. Wachstum, geistige Entwicklung) wurden keine Veränderungen gesehen. Die klinische Relevanz dieser Daten ist nicht klar.
Schwangerschafts-Diabetes
Eine rezente (18) Metaanalyse von sieben randomisierten Studien zeigte positive Effekte auf glykämische Parameter (wie Senkung des Blutzuckerspiegels und Insulin-Resistenz), jedoch keinen Unterschied in der Inzidenz von Diabetes.
Hypertriglyceridämie
Hierzu sei aus einer umfassenden Bewertung (19) von Medikamenten für diese Indikation zitiert: „Omega fatty acids are effective in lowering triglycerides and while not proven will likely reduce the risk of development of pancreatitis“.
Zusammenfassung
Für Omega-3 Fettsäuren (EPA und DHA: Omacor) ist derzeit nur mehr die Indikation bei Hypertriglyzeridämie belegt und zugelassen. Ob höhere Dosen von 4 Gramm pro Tag eine kardioprotektive Wirkung haben, muss erst bestätigt werden.
Für zahlreiche weitere Indikationen, bei denen man eine positive Wirkung erwartet hatte, liegen klar negative Resultate vor oder eine Bewertung ist noch umstritten. Es wiederholt sich hier die Erfahrung, die man mit Vitaminen machte. Obwohl eine vitaminreiche Ernährung und hohe Vitaminblutspiegel mit positiven Folgen für die Gesundheit korrelierten, brachten randomisierte Supplement-Studien in der normalen Bevölkerung weder für Vitamin A noch für die Vitamine C, D und E positive kardiovaskuläre oder sonstige Effekte und hatten mitunter sogar negative gesundheitliche Folgen (siehe Pharmainfo XIX/2/2004; XXII/2/2007; XXIX/4/2014).
Literatur
(1) Aung T et al, JAMA Cardiol 3, 225, 2018
(2) Abdelhamid AS et al, Cochrane Database Syst Rev, issue 7, 2018
(3) Ascent study, NEJM 379, 16, 2018
(3a) Manson JE et al, NEJM 380, 23, 2019
(3b) Bhatt DL et al, NEJM 380, 11, 2019
(3c) Kastelein JP et al, NEJM 180, 89, 2019
(4) Tabue-Teguo M et al, J Nutr Health Aging 22, 923, 298
(5) Andrieu S et al, Lancet Neurol 16, 377, 2017
(6) Cooper RE et al, Y Psychopharm 29, 753, 2015
(7) Burckhardt M et al, Cochrane Database Syst Rev, issue 4, 2016
(8) Gabbay et al, J Clin Psych 79, 17m11596, 2018
(9) Robinson DG et al, Schizo Res, online
(10) Jahangard L et al, J Psych Res 107, 48, 2018
(11) Zheng-Gang Bai et al, J Affektive Dis 24, 241, 2018
(12) Manson JE et al, NEJM 380, 33, 2019
(13) Hull MA et al, Lancet 392, 2583, 2018
(14) Gillies D et al, Cochrane Library, issue 10, 2012
(15) Chang JPC et al, Neuropsychopharm 43, 534, 2018
(16) Banaschewski T et al, Nutrition & Health, online
(17) Middleton P et al, Cochrane Database Syst Rev, issue 11, 2018
(18) Gao L et al, J Matern Fetal Neonatal Med, online
(19) Grunfeld C, Triglyceride Lowering Drugs: NCBI Bookshelf, Last update 2017
Zur Inzidenz von Nebenwirkungen
Insbesondere für seltenere Nebenwirkungen sind genaue Zahlen zur Inzidenz schwer zu finden. Für die Risiko-Nutzenbewertung eines Medikamentes sind sie aber wichtig. Zwei rezente Beispiele seien diskutiert.
Hydrochlorothiazid
(HCT; in zahlreichen Medikamenten zur Hochdrucktherapie enthalten): Der Einfluss dieser Substanz auf die Inzidenz von nicht-melanozytärem Hautkrebs wurde in einer großen pharmakoepidemiologischen Studie (1) untersucht: 71.553 Fälle von Basalzellkarzinomen (BCC) und 8.629 von Plattenepithelkarzinomen (squamous cell carcinoma: SCC). Insgesamt stieg das Risiko sowohl für BCC (OR 1,29, 95% CI: 1,23-1,35) als auch für SCC (OR 3,98, 3,68-4,31). Diese Risikoerhöhung war dosisabhängig. Erst ab einer kumulativen Dosis von 50.000 mg (bei 12,5 mg/Tag ca. 12,5 Jahre Therapie) war sie signifikant für BCC und ab 25.000 mg (über 6 Jahre Therapie) für SCC, wobei bei diesem Tumor ab 200.000 mg (50 Jahre Therapie) das Risiko auf eine OR von 7,38 anstieg. Bei jüngeren PatientInnen war das Risiko höher.
Epidemiologische Beobachtungsstudien können keine Kausalität beweisen. Die klare Dosisabhängigkeit und die Tatsache, dass andere untersuchte Antihypertensiva das Risiko nicht erhöhten, macht diese aber wahrscheinlich.
Als mögliche Ursache für diese Risikoerhöhung wurde die bekannte durch HCT ausgelöste Photosensibilisierung diskutiert, was auch mit dem höheren Risiko für jüngere PatientInnen übereinstimmen würde.
Für die Inzidenz dieser Tumore in der Bevölkerung wurden unterschiedliche Daten berichtet, aber in den letzten Jahren kam es zu einem Anstieg (2,3). Für BCC wurde in England sogar der Spitzenwert von 490 Fällen pro 100.000 Personenjahren gefunden (2). Wenn wir diesen hohen Wert nehmen, steigt die Inzidenz für BBC unter HCT auf 630 an (OR 1,3), für SCC bei einer Inzidenz von 50/100.000 PatientInnenjahren auf 200 Fälle (OR 4,0). Dies ergibt ca. 3 zusätzliche Fälle für beide Tumore pro 1000 behandelten PatientInnen pro Jahr. Etwas dramatischer erscheint es, wenn die dänischen ÄrztInnen (1) kalkulieren, dass 9% aller SCC durch diese Therapie ausgelöst sein könnten (0,6% für BCC).
Risiko/Nutzenbewertung: HCT stellt eine der wichtigen Säulen der Hochdrucktherapie mit gut belegter Wirkung auf die kardiovaskuläre Mortalität dar. Die vorliegenden Daten sollten noch eine Bestätigung erhalten. Es ist aber schon jetzt zweckmäßig auf auffällige Hautveränderungen (auch von Seiten der PatientInnen) zu achten, und dies gilt insbesondere für lichtexponierte und junge PatientInnen und nach mehr als 6 Jahren Therapie (siehe auch Mitteilung der Zulassungsinhaber vom 16.10.2018).
Fluorochinolone
(Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin, Ofloxacin, Prulifloxacin: Generika). Für diese Antibiotika sind signifikante Nebenwirkungen wie periphere Neuropathie, Depressionen, Suizidrisiko, Sehnenrupturen u.a. schon länger bekannt. Für Sehnenrupturen (insbesondere Achillessehne) und für Aortenaneurysma sind Inzidenzzahlen publiziert. In einer großen (1,7 Mio. PatientInnen) Kohortenstudie (4) aus Kanada wurden Nebenwirkungen unter Chinolontherapie untersucht. Insgesamt erhielten 657.950 PatientInnen (38%) während des Beobachtungszeitraums zumindest einmal ein Chinolon. Von diesen traten bei 37.338 (2,1%) Sehnenrupturen auf. Im Vergleich zu jenen PatientInnen, die keine Chinolone erhielten, bedeutet das ein Risiko für Sehnenrupturen von 0,82 vs 0,26/100- Personenjahre (hazard ratio, HR 2,40; p<0.001). Dies würde bedeuten, dass ca. ein Patient/eine Patientin von 200 durch diese Therapie eine Sehnenruptur erleidet. Das liegt im Rahmen früherer Beobachtungen (5), im Durchschnitt kam es 19 Tage nach Therapie zu Rupturen. Als Wirkungsmechanismus wird eine Aktivierung von Metalloproteinasen, die zur Schädigung von Kollagen führt, diskutiert.
Eine rezentere retrospektive Kohortenstudie (6) fand für Achillessehnen „injury" (nicht nur Rupturen) eine Inzidenz von 0,37% während und bis 6 Monate nach Chinolontherapie. Im Vergleich dazu waren es bei PatientInnen unter einer anderen Antibiotikatherapie 0,3%. Dies ergibt eine NNH (number needed to harm) von 1.397, also ein Patient/eine Patientin von 1.397 behandelten erleidet einen zusätzlichen Sehnenschaden. Diese Inzidenz ist deutlich niedriger als in der obigen und den früheren Arbeiten. Es könnte daran liegen, dass hier als Kontrollgruppe PatientInnen mit einer anderen Antibiotikatherapie dienten. Beim Vergleich mit PatientInnen ohne Antibiotikatherapie war die NNH deutlich niedriger (895). Dies würde für ein „confounding by indication“ sprechen, d.h. PatientInnen mit Infektionen und Antibiotikatherapie haben bereits ein höheres Risiko für Sehnenschäden.
Kollagen ist auch für die Aortenwand und für die Adhärenz der Netzhaut relevant. Tatsächlich wurde in der obigen Studie (4) auch ein erhöhtes Risiko für Aortenaneurysma gefunden, und zwar ein Anstieg von 0,13 auf 0,35/100 PatientInnenjahre, also ein zusätzlicher Fall pro 430 PatientInnen pro Jahr (1). Für Netzhautablösung war kein signifikant höheres Risiko gegeben (frühere Studien waren widersprüchlich). Die rezenteste Arbeit (7) bezüglich Aortenaneurysma fand für die Risikoperiode von 60 Tagen mit und nach Chinolontherapie 0,12 Fälle/100 PatientInnenjahre versus 0,07/100 PatientInnenjahre im Vergleich zu Amoxicillintherapie, also ca. nur 1 Fall pro 2.000. Ein Risiko für Aortenaneurysma erscheint gegeben, für die Abschätzung der tatsächlichen Inzidenz sind weitere Studien notwendig.
Eine neue Risiko-Nutzenbewertung für Chinolone ist kürzlich von der EMA* durchgeführt worden. Auf Grund der doch gravierenden und relativ häufigen Nebenwirkungen wurde eine Einschränkung der Indikation beschlossen (EMA/795349/2018, 16/11/2018), insbesondere keine Verwendung bei Blaseninfektionen, Reisediarrhoe und auch nicht bei leichten bis mittelschweren Infektionen, wenn Alternativen zur Verfügung stehen.
Diese zwei Beispiele zeigen, dass auch bei schon lange am Markt befindlichen Medikamenten Risiken erst sehr spät erkannt werden und genauere Inzidenzen entweder spät vorliegen oder oft auch noch widersprüchlich sind.
(*EMA: bisher in London, 2019 ist diese erfolgreiche europäische Institution nach Amsterdam übersiedelt).
Literatur
(1) Pedersen SA et al, J Am Acad Derm 78, 673, 2018
(2) Devine D, BR J Oral Max Surg 56, 101, 2018
(3) Keena S et al, J Am Acad Derm 78, 237, 2018
(4) Daneman N et al, BMJ open 5, e010077, 2015
(5) Stephenson AL et al, Drug Saf 36, 709, 2013
(6) Jupiter DC et al, Pharmacother 38, 878, 2018
(7) Pasternak P et al, BMJ 360, k678, 2018
Diclofenac: weitere Daten zum Risiko
Wir haben bereits 2008 (Pharmainfo XXIII/3/2008) darauf hingewiesen, dass Diclofenac (Generika) als präferenzieller Cyclooxygenase-2 (Cox-2) - Hemmer ein mit diesen Substanzen vergleichbares kardiovaskuläres Risiko zeigt, während dies für Naproxen (Generika) nicht der Fall sei. Wir haben dann über eine große Metaanalyse randomisierter Studien (1, siehe Pharmainfo XXVIII/3/2013) berichtet, in der für schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse (Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskuläre Mortalität) mit Diclofenac ein hohes Risiko gefunden wurde und zwar 3 zusätzliche Fälle (davon einer tödlich) pro 1000 PatientInnen, bei RisikopatientInnen sogar 7 bis 8 schwere Ereignisse/1000 (davon zwei tödliche). Für hohe Dosen (2400 mg) von Ibuprofen war ein erhöhtes Risiko auch möglich, für niedrige Dosen (< 1200 mg) wurde allerdings kein Risiko gefunden (2, siehe auch 3). Bei Naproxen war kein Risiko gegeben.
Eine rezente Arbeit (4) hat nun diese Daten bestätigt und erweitert. Es handelt sich um eine geplante Serie von Kohortenstudien, die sich auf das dänische Health Register (1996-2016) bezieht und z.B. 1.370.882 PatientInnen erfasst, die eine Therapie mit Diclofenac begannen. Diese Daten wurden mit PatientInnen unter Naproxen, Ibuprofen (Generika), Paracetamol und „Non-users“ von NSARs verglichen. Für schwere kardiovaskuläre Ereignisse (Vorhofflimmern, ischämischer Schlaganfall, akuter Herzinfarkt und kardiovaskuläre Mortalität) war mit Diclofenac das Risiko 50% höher als für Non-user, wobei alle einzelnen Risikoparameter bei Verwendung von Diclofenac in erhöhter Inzidenz vorkamen. Im Vergleich zu Ibuprofen war das Risiko mit Diclofenac um 20%, gegenüber Paracetamol und Naproxen um 30% höher. Da aber zumindest für Naproxen und Paracetamol keine Hinweise auf ein kardiovaskuläres Risiko vorliegen, könnte dies dafür sprechen, dass ein „confounding by indication“ vorliegt, d.h. dass PatientInnen, die eine Schmerztherapie erhalten, bereits ein etwas höheres Risiko als Non-user für kardiovaskuläre Ereignisse haben.
Auf jeden Fall hat Diclofenac ein hohes Risiko. In absoluten Zahlen ausgedrückt: pro 1000 PatientInnen pro Jahr haben 4 ein schweres kardiovaskuläres Ereignis (davon eines tödlich), bei PatientInnen mit moderatem kardiovaskulärem Risiko (PatientInnen mit Diabetes) schon 14 Events und bei hohem Risiko (nach Myokardinfarkt und Herzinsuffizienz) 40 (davon 20 tödlich). Dies bedeutet eine NNH von 250 für alle PatientInnen, bzw. bei HochrisikopatientInnen von 25 (!).
Dies gilt sowohl für niedrige und hohe Dosierungen als auch für einen kurzen Risikozeitraum von 30 Tagen (bei 44% der PatientInnen erfolgte gar nur eine Verschreibung). Es gibt also „no safe window“ (siehe 3 und Pharmainfo XXXII/1/2017).
Im Vergleich zur oben erwähnten Metaanalyse (1) ist die Übereinstimmung für nicht-RisikopatientInnen gut (4 versus 3 Events), aber bei höherem kardiovaskulärem Risiko (14 und 20 versus 7 bis 8) deutlich höher.
Eine weitere Studie bei Arthritis-PatientInnen (5: nested case control) fand ebenfalls für Diclofenac ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, aber keines für Naproxen.
Als Ursache für den negativen Effekt von Diclofenac (siehe 4) wird die aufgrund der Cox-2 Selektivität während eines Dosierungsintervalls länger anhaltende Hemmung der Cox-2 angesehen, während die Cox-1 Hemmung rascher abnimmt ("Fenster mit selektiver Cox-2 Hemmung", 4). Dies reduziert die Cox-2 – vermittelte Bildung des vaskulär nützlichen Prostaglandins Prostacyclin. Bei Naproxen und Ibuprofen wird dieses Fenster nicht beobachtet und es steht die Hemmung der Cox-1, die für die Bildung des „schädlichen“ (prothrombotischen) Thromboxans A2 verantwortlich ist, im Vordergrund.
Schon auf Grund der früheren Daten ist die Indikation für Diclofenac von der EMA eingeschränkt worden (siehe Fachinformation). Kontraindikationen sind Herzinsuffizienz, ischämische Herzerkrankungen, periphere Durchblutungsstörungen und cerebrovaskuläre Erkrankungen. Offensichtlich ist das berechtigt, wenn man die NNH von 25 (siehe oben) für solche PatientInnen bedenkt.
Kontraindikation heißt, das Medikament darf bei diesen PatientInnen nicht verwendet werden. Trotzdem steht dann bei den Warnhinweisen folgendes: PatientInnen mit Herzinsuffizienz, bestehender ischämischer Erkrankung, peripherer arterieller Gefäßerkrankung und/oder cerebrovaskulären Erkrankungen dürfen erst nach sorgfältiger Abwägung behandelt werden. Bei einer NNH von 25 ist keine Abwägung mehr zulässig. Eine Korrektur der Fachinformation erscheint dringend notwendig.
Für PatientInnen mit weiteren Risikofaktoren (z.B. Hypertonie, Hyperlipidämie, Diabetes mellitus, Rauchen) sollte ebenfalls eine sorgfältige Risiko-Nutzenabwägung erfolgen. Für Diabetes-PatientInnen hat die obige Studie eine NNH von 71 ergeben. Zu den genannten Risikofaktoren gibt es aber weitere wie Adipositas und Dauerstress. Weiters ist das spezifische Risiko bei vielen PatientInnen nicht genau bekannt.
Trotz dieser Einschränkungen sind die Verordnungszahlen für Diclofenac noch immer hoch. Sie sind zwar ab 2012 jeweils gesunken (2017 um 10,8%), während diese für Naproxen gestiegen sind (6). Diclofenac nimmt aber mit millionenfacher Verschreibung hinter Ibuprofen und deutlich vor Naproxen immer noch den zweiten Platz ein (6).
Zum Abschluß sei zitiert: “When prescribing traditional NSAID, older selective Cox-2 inhibitors such as diclofenac should be avoided” (Position paper European Society of Cardiology, 3). In der rezenten Metaanalyse (4): “Treatment of pain and inflammation with NSAIDs may be worthwhile for some patients, however, there´s little justification to initiate diclofenac treatment before other traditional NSAIDs“.
Literatur
(1) Coxibtrialists, Lancet 382, 769, 2013
(2) McGettigan et al, Plos Medicine 8, e1001098, 2011
(3) Schmidt,M et al, Eur Heart J 37, 1015, 2016
(4) Schmidt,M et al, BMJ 362, k3426, 2018
(5) Dubreuil M et al, Ann Rheum Dis 77, 1137, 2018
(6) Schwabe U, Arzneiverordnungsreport 2018
Calcitonin gene-related peptide (CGRP) - gerichtete therapeutische Antikörper zur Migräneprävention
Wie in Pharmainfo XXI/2/2006 beschrieben, ist die Therapie akuter Migräneanfälle und insbesondere deren Prävention für viele PatientInnen unzureichend. Derzeit zugelassene Prophylaktika zeichnen sich jedoch aufgrund oft unzureichender Wirksamkeit oder Verträglichkeit durch schlechte Therapieadhärenz und -persistenz aus (1). Der langsame Fortschritt in der Entwicklung neuer wirksamer Migränetherapeutika ist vor allem durch das noch unvollständige Verständnis der Pathophysiologie dieser speziellen, paroxysmalen Schmerzerkrankung bedingt, welche sich vor allem auch durch eine Amplifizierung sensorischer Reizwahrnehmung, einschließlich von Schmerz, auszeichnet (2). Präklinische Forschung (auch basierend auf Mausmodellen mit seltenen beim Menschen Migräne-verursachenden Mutationen) und moderne bildgebende Verfahren erlauben jedoch zunehmend Einblick in die komplexe Pathophysiologie, welche heute als veränderter Erregungszustand des Gehirns mit Störung der Funktion komplexer Gehirnnetzwerke unter Einbeziehung kortikaler und subkortikaler Regionen, sowie des Hirnstamms verstanden wird (2,3). Sehr wahrscheinlich werden Anfälle durch Aktivierung von kraniofazialen Schmerzfasern vor allem des Nervus Trigeminus getriggert, welche auch Blutgefäße der Pia und Dura mater versorgen und die einzigen schmerzempfindlichen intrakraniellen Strukturen darstellen. Bei Erregung setzen diese Nervenendigungen proinflammatorische vasodilatierende Mediatoren (wie unter anderem die Peptide CGRP und Substanz P) frei und verstärken damit das nozizeptive Signal (sog. trigeminovaskuläres System). Synaptische Übertragung der Schmerzinformation von trigeminalen Afferenzen auf Neurone im Hirnstamm führt in der Folge zur Aktivierung subkortikaler Schmerznetzwerke, autonomer (v.a. des Hypothalamus) und höherer Zentren, einschließlich sensorischer Kortexareale. Dieser selbst-perpetuierte Prozess erklärt neben dem Kopfschmerz auch die mit einem Migräneanfall einhergehenden vegetativen (v.a. Übelkeit) und sensorischen (Osmophobie, Phonophobie, Photophobie, Allodynie) Symptome (2). Aktivitätsveränderungen in diesen neuronalen Netzwerken lassen sich auch schon während der Prodromalphase (mit z.B. Stimmungsschwankungen, Gähnen, Durst) Stunden bis Tage vor dem Anfall nachweisen (4). Sehr gut verstanden wird auch die Entstehung der Aura-Symptomatik (ca. 30% der PatientInnen), welcher eine sich langsam über kortikale Areale ausbreitende neuronale Erregungswelle ("cortical spreading depression") zugrunde liegt. Diese wird ebenfalls als einer der pathologischen Trigger der abnormen Erregung des trigeminovaskulären Systems vermutet. Der Übergang von episodischer Migräne zu chronischer Migräne (definiert als Kopfschmerzen an 15 oder mehr Tagen pro Monat über mehr als 3 Monate und mit mindestens 8 Tagen Migränekopfschmerz pro Monat) kann durch eine dauerhafte Veränderung neuronaler Funktionen ("Plastizität") und Strukturen (analog einem "Schmerzgedächtnis") bei anhaltender Migränedauer erklärt werden (2).
Die auch in Hinblick auf neue Therapieansätze entscheidende Frage, wodurch eine typische Migräneattacke ausgelöst wird, bleibt weiter unbeantwortet. Die Beteiligung peripherer (kraniofazial-zervikal) bzw. zentraler (cortical spreading depression) Trigger im Bereich des trigeminovaskulären Systems ist wahrscheinlich. Eine wichtige Voraussetzung scheint jedoch eine, vermutlich genetisch determinierte, erhöhte neuronale Erregbarkeit zu sein, welche zumindest für seltene, autosomal dominant vererbte Formen der Migräne als erwiesen gilt (5). Wenngleich noch lückenhaft kann dieses pathophysiologische Modell plausibel die Wirkungen von Triptanen (Hemmung der Aktivität zentraler trigeminaler Neurone und der CGRP-Freisetzung), von Antiepileptika wie Valproinsäure und Topiramat in der Migräneprophylaxe (Reduktion neuronaler Übererregbarkeit) und auch die prophylaktische Wirkung von Botulinumtoxin (Hemmung der Neuropeptidfreisetzung in peripheren kraniofazial-zervikalen Schmerzfasern) erklären (3). Weiters lassen sich daraus neue Migräne-spezifische pharmakologische Angriffspunkte ableiten.
Die Hemmung CGRP-vermittelter Wirkungen hat sich dabei als das bisher erfolgreichste Konzept herauskristallisiert. Während sich die klinische Entwicklung oraler CGRP-Rezeptorantagonisten (sog. "-gepants") wegen möglicher Lebertoxizität verzögert hat, wurden die therapeutischen monoklonalen Antikörper Erenumab (Aimovig), Galcanezumab (Emgality) und Fremanezumab (Ajovy) für die Migräneprophylaxe bereits zugelassen.
Erenumab bindet an den CGRP-Rezeptor (und verhindert die Interaktion mit CGRP), während Galcanezumab und Fremanezumab an CGRP binden. Die pathophysiologische Bedeutung von CGRP ergibt sich nicht nur aus seiner Freisetzung vor allem aus trigeminalen Neuronen bei Migräneattacken, sondern auch aus seiner Fähigkeit, nach systemischer Applikation ähnlich wie Nitroglyzerin Migräneanfälle bei MigränikerInnen auslösen zu können. Somit stellen anti-CGRP Antikörper die ersten speziell für die Migräneprophylaxe entwickelten Arzneimittel dar. Aber bringt dies auch einen entsprechenden therapeutischen Vorteil?
Erenumab (70 mg alle 4 Wochen subkutan) und Galcanezumab (120 mg alle 4 Wochen subkutan mit 240 mg Initialdosis) sind zur Migräne-Prophylaxe bei Erwachsenen mit mindestens 4 Migränetagen pro Monat (und somit für episodische und chronische Migräne) zugelassen. Die Studiendesigns in den pivotalen randomisierten, Placebo-kontrollierten Studien bei episodischer Migräne und die darin eingeschlossenen PatientInnenkollektive (6-8) waren sehr ähnlich. Randomisiert wurden 18-65-jährige PatientInnen (Durchschnittsalter ca. 41 Jahre, ca. 85% Frauen) mit Krankheitsbeginn vor dem 50. Lebensjahr, mindestens einjähriger Krankheitsdauer und 4-14 Migränetagen pro Monat in den letzten drei Monaten. PatientInnen, welche zuvor auf >2 Migräneprophylaktika nicht angesprochen hatten, waren von der Studie ausgeschlossen.
Andere Migräneprophylaktika waren nicht erlaubt (mit Ausnahme bei etwa 3% der TeilnehmerInnen in der Erenumab-Studie). Nach einer 4-5-wöchigen Screeningphase wurden die PatientInnen mit Verum (Erenumab 70 und 140 mg; Galcanezumab 120 und 240 mg) über 6 Monate doppelblind behandelt. Primärer Endpunkt war die Reduktion der monatlichen Migränetage, wichtiger sekundärer Endpunkt der Anteil der Responder (mit >50% Reduktion der Migränetage).
Erenumab (ca. 315 PatientInnen pro Behandlungsgruppe; 6) reduzierte die monatlichen Migränetage von einem Ausgangswert von durchschnittlich ca. 8,3 um 3,2 (70 mg, zugelassene Standarddosis) bzw. 3,7 Tage (140 mg), Placebo um 1,8 Tage. Galcanezumab (ca. 220 PatientInnen pro Verumgruppe; 2 unabhängige Studien; 7,8) war ähnlich wirksam: Reduktion der monatlichen Migränetage von durchschnittlich ca. 9,1 um 4,3 (120 mg) bzw. 4,2 Tage (240 mg), Placebo um 2,3 (7). Placebo-korrigiert entspricht das also bei beiden Substanzen einer zusätzlichen Reduktion um 2 Migränetage pro Monat in der Gesamtpopulation. Ein ähnlicher Unterschied wurde auch in der Subgruppe der PatientInnen mit weniger als 8 monatlichen Migränetagen beobachtet (9; Aimovig EPAR). Auch der Anteil der PatientInnen mit einer 50% Abnahme der monatlichen Migränetage war bei beiden ähnlich und um ca. 23% höher als bei Placebo (Erenumab 43% – 50% vs 27%; Galcanezumab 59-62% vs 36-38%; 7,8). Ein therapeutischer Effekt war auch in anderen sekundären Zielparametern gegenüber Placebo erkennbar, wie der Reduktion monatlicher Migränetage, an denen Migränemittel eingenommen wurden, um 1-2 Tage und moderaten Verbesserungen in von PatientInnen-beurteilten Outcomes.
In Studien mit Migräneprophylaktika bei episodischer Migräne ist es üblich, PatientInnen, welche zuvor auf >2 Migräneprophylaktika nicht angesprochen haben, von der Studie auszuschließen (sh. z.B. 10,11). Gerade diese PatientInnen könnten aber am meisten von einer neuen Therapie profitieren - aus Sicht der PatientInnen und ÄrztInnen daher ein wenig zufriedenstellendes Studiendesign. Derzeit liegt nur für Erenumab in hoher Dosierung (140 mg monatlich) eine entsprechende Placebo-kontrollierte Studie über 12 Wochen vor (120 PatientInnen pro Gruppe; 12). In diese wurden nur PatientInnen mit bereits 2 - 4 erfolglosen Therapieversuchen (wegen fehlender Wirkung oder wegen Unverträglichkeit) mit anderen Migräneprophylaktika eingeschlossen (wobei Propranolol, Metoprolol, Topiramat, Flunarizin oder Valproinsäure versucht werden mussten oder nicht in Frage kamen). Die 50% Responderraten (primärer Endpunkt) waren in der Erenumabgruppe höher (30% vs 14% in der Placebogruppe), und es kam zu einer Abnahme um 1,6 monatliche Migränetage (1,8 vs. 0,2). Dies ist ein Hinweis auf Wirksamkeit von Erenumab auch bei mehrfach erfolglos vorbehandelten PatientInnen. Leider wurde keine getrennte Analyse für das jeweilige Ansprechen von PatientInnen mit Therapieversagen aufgrund fehlender Wirkung oder aufgrund von Unverträglichkeit durchgeführt.
Die wichtigsten Studien bei PatientInnen mit chronischer Migräne (≥ 15 Kopfschmerztage pro Monat, davon 8 mit Migräne) waren ebenfalls ähnlich konzipiert. Durch entsprechende Einschlußkriterien waren die meisten PatientInnen mit ≥ 1 Prophylaktikum vorbehandelt und durften (mit wenigen Ausnahmen in der Galcanezumab-Studie) keine Prophylaxe erhalten. PatientInnen mit erfolgloser Vorbehandlung mit mehr als 3 Prophylaktika waren ausgeschlossen. Die eingeschlossenen PatientInnen hatten durchschnittlich 18 - 19 Kopfschmerztage pro Monat (13,14). Etwa die Hälfte litt an "Medication Overuse". Sowohl Erenumab (70 mg oder 140 mg) als auch Galcanezumab reduzierten die Kopfschmerztage gegenüber Placebo um zusätzlich 2,4 (6,6 vs 4,2) bzw 2 (4,7 vs 2,7) Tage. Die 50% Responderraten waren mit beiden CGRP-Blockern um 18% (Erenumab: 41% vs 23%) bzw. 13% (Galcanezumab: 28% vs 15%) höher. In der Gruppe nicht vorbehandelter PatientInnen war die 50% Responderrate für Erenumab (140 mg) auf Placeboniveau, umgekehrt in der Gruppe mit ≥ 2 Vortherapien sogar 22% der PatientInnen nach 3 Monaten eine ≥ 75% Reduktion der monatlichen Migränetage erreichten (nur 3,5% mit Placebo). Der im Unterschied zu nicht vorbehandelten PatientInnen sehr geringe Placebo-Response könnte daraufhin deuten, dass diese PatientInnen eine sehr realistische Erwartungshaltung an eine erfolgreiche Therapie haben. Dies unterstützt eine Einschränkung der Verordnung (sh. unten) vor allem auf bereits mehrfach erfolglos vorbehandelte PatientInnen, da bei diesen ein Therapieerfolg mit höherer Wahrscheinlichkeit tatsächlich der Wirksubstanz zugeordnet werden kann.
Fremanezumab ist in den USA (als Ajovy) bereits zugelassen, sowohl für die s.c. Applikation 1 mal monatlich (225 mg) als auch alle drei Monate (675 mg). In Europa ist die Zualssung bereits vom CHMP empfohlen (Stand Jänner 2019). Beide Dosierungen zeigten in klinischen Studien eine sehr ähnliche Wirkung wie Erenumab und Galcanezumab. Prospektive Head-to-head Vergleichsstudien unter den CGRP-Blockern oder kontrollierte Vergleichsstudien mit anderen Migräneprophylaktika liegen derzeit nicht vor. Daher bleibt unklar, ob CGRP-Blocker, trotz ihres innovativen Konzepts, bestehenden Therapien in ihrer Wirkung überlegen sind.
In allen genannten Studien waren unerwünschte Wirkungen auf Placeboniveau, mit Ausnahme lokaler Reaktionen an der Einstichstelle und sehr seltenen Hypersensitivitätsreaktionen. Neutralisierende Antikörper wurden selten beobachtet und scheinen nicht therapierelevant zu sein. Ausführliche Langzeitsicherheitsdaten liegen noch nicht vor. Ergebnisse von open-label Langzeitstudien über ein Jahr (Erenumab: 307 PatientInnen, Galcanezumab: 210 PatientInnen) ergaben bisher keine Bedenken hinsichtlich Verträglichkeit und Sicherheit und lassen einen anhaltenden Therapieeffekt vermuten (15,16). CGRP findet sich in vielen zentralen und peripheren Neuronen, und von Nervenendigungen freigesetztes CGRP wird mit vielen physiologischen Funktionen in Verbindung gebracht, wie Protektion der gastrointestinalen Mucosa, Angiogenese bei Wundheilung, Lymphangiogenese und Revaskularisierungsvorgängen nach ischämischen Ereignissen (Hirn, Herz; 17). Daher waren PatientInnen mit schweren Herz-Kreislauferkrankungen in den klinischen Studien ausgeschlossen, sodass für diese noch keine Sicherheitsdaten vorliegen.
Die Ergebnisse dieser Studien mit unterschiedlichen Substanzen zeigen übereinstimmend und mit fast identischen Effektgrößen die Überlegenheit von CGRP-Blockern gegenüber Placebo. Allerdings ist das Ausmaß der Wirkungen bescheiden. Sowohl bei episodischer als auch chronischer Migräne werden die monatlichen Tage mit Migränekopfschmerz zusätzlich zu Placebo um ca. 2 Tage reduziert und der Anteil der 50% Responder je nach Studie um 13-23% erhöht. Das Ausmaß der Wirkung ist damit vergleichbar mit jenem anderer für die Migräneprophylaxe zugelassener Medikamente wie z.B. von Valproinsäure (Convulex; 11,18,19), Topiramat (Topamax, Generika; 20,21) oder Betablockern (22) bei episodischer Migräne und jener von Topiramat (23) oder Onabotulinumtoxin A (Botox) bei chronischer Migräne (24). Dies wird auch von FDA (25,26) und EMA (9) so gesehen.
Die Vorteile der Therapie sind somit die fehlende Notwendigkeit einer einschleichenden Dosistitration wie für die meisten oralen Alternativen, rascher Wirkungseintritt innerhalb der ersten 2-3 Monate, das Fehlen therapierelevanter Arzneimittelinteraktionen, das Ansprechen auch bei PatientInnen mit Therapieversagen auf mehrere Migräneprophylaktika und die gute Verträglichkeit.
Nachteile sind das Ansprechen nur einer Untergruppe von PatientInnen, die noch fehlenden Daten zur Langzeitsicherheit und der hohe Preis im Vergleich zu therapeutischen Alternativen.
Eine Reduktion der monatlichen Migränetage in den Verumgruppen um bis zu 7 Tage bei chronischer und 3-4 Tage bei episodischer Migräne und Reduktion der Kopfschmerztage auf die Hälfte bei etwa 50% der PatientInnen sind aus der Sicht der PatientInnen oder der behandelnden ÄrztInnen klinisch relevant. Allerdings kann, ähnlich wie bei anderen Prophylaktika, etwa 50% dieser Wirkung in der Placebogruppe beobachtet werden und ist daher nicht auf den Wirkstoff zurückzuführen. In Anbetracht der zu erwartenden hohen Behandlungskosten für diese Präparate und aufgrund der noch unklaren Langzeitsicherheit sollten CGRP-Blocker vorwiegend PatientInnen vorbehalten bleiben, welche auf eine ausreichend lange Therapiemit mehreren anderen verfügbaren oralen Migräneprophylaktika nicht angesprochen haben (auf eine Sicherstellung verlässlicher Kontrazeption und deren Dokumentation bei Therapie mit Valproinsäure und Topiramat bei fruchtbaren Frauen ist dabei besonders zu achten). Außerdem sollte der Therapieversuch bei inadäquatem Ansprechen abgebrochen werden. Aufgrund des raschen Wirkungseintritts kann dies bei beiden Substanzen (mit 1-mal monatlicher Gabe) nach 3 Monaten beurteilt werden. Als Ansprechkriterien empfehlen sich ≥ 50% Abnahme der monatlichen Kopfschmerztage oder deutliche Besserung subjektiver Beschwerden in Migräne-spezifischen validierten Questionnaires (z.B. Headache Impact Tests; 27,28; Migraine Physical Function Impact Diary, MPFID;29).
Fazit
CGRP-Blocker stellen eine weitere Therapieoption dar mit - bei derzeitiger Datenlage - vergleichbarer therapeutischer Wirkung zu etablierten Migräneprophylaktika. Bestimmte PatientInnen könnten jedoch von einer Therapie mit diesen Antikörpern profitieren. Welche PatientInnen besonders gut ansprechen lässt sich allerdings derzeit aufgrund fehlender validierter Biomarker oder klinischer Parameter nicht vorhersagen. Einer besseren Verträglichkeit steht eine noch unbekannte Langzeitsicherheit gegenüber. Aus diesem Grund und auch aufgrund ökonomischer Aspekte erscheint ein zurückhaltender Einsatz daher derzeit angebracht.
Literatur
(1) Hepp Z et al, J Manag Care Pharm20, 22, 2014
(2) Brennan KC et al, Neuron 97, 1004, 2018
(3) Goadsby PJ et al, Physiol Rev 97, 553, 2017
(4) Karsan N et al, CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology 24, 996, 2018
(5) Pietrobon D et al, Nat Rev Neurosci 4, 386, 2003
(6) Goadsby PJ et al, New Engl J Med 377, 2123, 2017
(7) Skljarevski V et al, Cephalalgia: An Int J Headache 38, 1442, 2018
(8) Stauffer VL et al, JAMA Neurol 75, 1080, 2018
(9) EMA, 2018, AIMOVIG - EPAR. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/aimovig
(10) Diener H-C et al, J Neurol 251, 943, 2004
(11) Freitag FG et al, Neurology 58, 1652, 2002
(12) Reuter U et al, Lancet 392, 2280, 2018
(13) Detke HC Neurology 91, e2211, 2018
(14) Tepper S et al, Lancet Neurol 16, 425, 2017
(15) Ashina M et al, Neurology 89, 1237, 2017
(16) Camporeale A et al, BMC Neurol 18, 188, 2018
(17) Majima M et al, Trends Pharmacol Sci 40, 11, 2019
(18) Mathew NT et al, Arch Neurol 52, 281, 1995
(19) Klapper J et al, Cephalalgia 17, 103, 1997
(20) Silberstein SD et al, Arch Neurol 61, 490, 2004
(21) Brandes JL et al, JAMA 291, 965, 2004
(22) Silberstein SD, Neurology 78, 1337, 2012
(23) Silberstein S et al, Headache 49, 1153, 2009
(24) Diener, H.C. et al Cephalalgia 30, 804, 2010
(25) FDA, 2018, Summary Review Emgality. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2018/761063Orig1s000TOC.cfm
(26) FDA, 2018, FDA Summary Review Aimovig. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2018/761077Orig1s000TOC.cfm
(27) Smelt AF et al, Cephalalgia 34, 29, 2014
(28) Coeytaux RR et al, Journal of Clin Epidemiol 59, 374, 2006
(29) Hareendran A et al, Health Qual Life Outcomes 15, 224, 2017
P.b.b. Erscheinungsort Verlagspostamt 1010 Wien
Montag, 4. März 2019
Pharmainformation
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.



