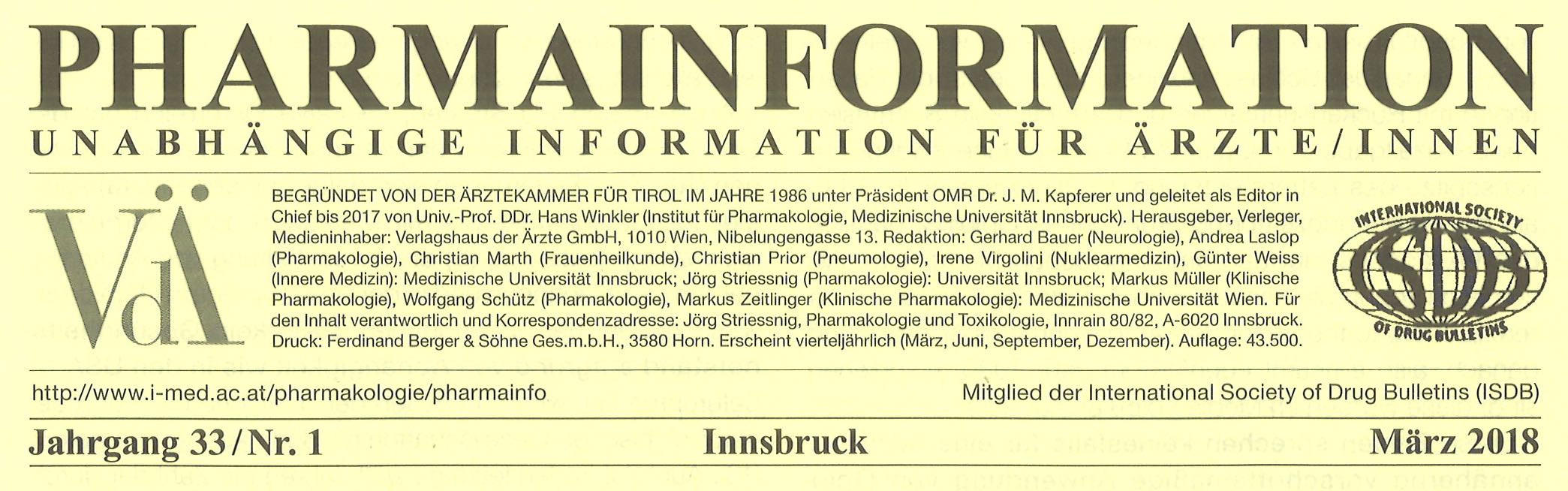
Inhalt
- Persönliches Editorial (Hans Winkler)
- Drogenepidemie in den USA – ein Update zur Therapie mit Opioiden
- Antizytokintherapie bei Atherosklerose – Beginn einer neuen Ära?
- Mikronisiertes Dehydroepiandrosteron (DHEA) zur postmenopausalen Hormontherapie
Persönliches Editorial (Hans Winkler)
Seit der ersten Nummer der Pharmainformation im Jahr 1986 habe ich als Editor in Chief fungiert. In der Pharmainfo XXII/3/2007 zitierte ich im Zusammenhang mit der Therapie bei älteren Personen Phillip Roth mit dem Satz: „old age is a massacre“. Das „old age“ habe ich inzwischen erreicht (78 Jahre ), das „massacre“ ist mir aber noch erspart geblieben. Nach schweren Operationen (Aneurysma der Aorta) wurden mir aber meine biologischen Grenzen deutlich gemacht.
Schon seit einiger Zeit habe ich geplant, meine Funktion als Chief-Editor abzugeben. Jetzt ist das obligatorisch. Erfreulicherweise hat sich der Mitherausgeber Univ.-Prof. Dr. med. Jörg Striessnig bereit erklärt, meine Nachfolge anzutreten. Prof. Striessnig (Leiter der Abteilung Pharmakologie und Toxikologie am Institut für Pharmazie der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) ist ein international anerkannter Pharmakologe, der wissenschaftlich an neuen pharmakologischen Angriffspunkten forscht, sich aber auch seit Jahren kritisch mit dem Arzneimittelmarkt beschäftigt.
Den Mitherausgebern sei für die jahrelange Mitarbeit besonders gedankt. Ihr Enthusiasmus und ihre Kompetenz waren für 30 Jahre Pharmainfo entscheidend. Dies gilt auch für Frau Monika Viehweider, die mir über 30 Jahre durch ihre Administration meine Tätigkeit ermöglichte. Gedankt sei auch Prof. Reiner Fischer-Colbrie, der die Pharmainformation in das Internet gestellt hat (einschließlich Stichwörtersuche). Es ist der besonders dankenswerte Verdienst der Tiroler (Präsident A.Wechselberger) und Österreichischen Ärztekammer, dass diese unabhängige und kritische Publikation allen ÄrztInnen Österreichs zur Verfügung steht. Im Verlagshaus der Ärzte hat Mag. H. Schaub die Drucklegung bestens betreut.
Ich wünsche der Pharmainformation als kritische und unabhängige Publikation auch weiterhin viel Erfolg, das heißt viele interessierte LeserInnen.
Den bisherigen LeserInnen gilt zum Abschluss mein besonderer Dank.
Drogenepidemie in den USA – ein Update zur Therapie mit Opioiden
In den USA herrscht eine Drogenepidemie verheerenden Ausmaßes. Bei unter Fünfzigjährigen ist eine Drogenüberdosis bereits die häufigste Todesursache, Schusswaffen und Autounfall rangieren dahinter. Die Zahl der Drogentoten hat sich seit 1999 verzehnfacht (2016: 64.070) und über 70% davon sind auf Opioide zurückzuführen (1). Ursache der Epidemie ist aber nicht die Junkie-Szene, hier gehen die Todesfälle ebenso wie jene im Rahmen einer Methadon-Substitutionstherapie stetig zurück, sondern eine zunehmend unkontrolliert gewordene ärztliche Verschreibung von Opioid-haltigen Schmerzmitteln, die eng mit der Zahl der durch ein Opioid verursachten Todesfälle korreliert (2). So verstarben von den im Jahr 2015 durch eine Opioid-Überdosis verursachten Drogentoten bereits die Hälfe durch ein verschriebenes Opioid. Auch für die andere Hälfte gilt eine ursächliche Schmerztherapie mit Opioiden als wahrscheinlich (3). Derzeit sind rund zwei Millionen US-AmerikanerInnen von Opioiden abhängig (4). Deshalb hat der US-Präsident im August 2017 die Opioid-Krise zum nationalen Notstand ausgerufen (5). Wie kam es dazu? Wie in Europa (6) war auch in den USA (7) bis Mitte der 1990er Jahre die Schmerztherapie mit Opioiden bei TumorpatientInnen in hohem Maße unzureichend (s. Pharmainfo X/1/1995 und X/4/1995), denn die ÄrztInnen fürchteten, ihre PatientInnen könnten süchtig werden. Diese Zurückhaltung machte den Herstellerfirmen sehr zu schaffen, deren Produkte nicht das erhoffte Geschäft erbrachten. Von einem bloß aus fünf Sätzen bestehenden „Letter to the Editor“, der 1980 im renommierten New England Journal of Medicine erschien (8), erhofften sie die Wende. Es wird dort von einem Monitoring an 11.882 PatientInnen berichtet, die während ihres Spitalsaufenthalts zumindest ein Opioid erhielten; dabei hätte sich bloß bei vier (Opioid-naiven) PatientInnen eine Abhängigkeit entwickelt. Die Schlussfolgerung war, dass die in Spitälern weit verbreitete Gabe von Opioiden nur selten in einer Abhängigkeit resultiert.
Tatsächlich als „full paper“ publiziert wurde der Inhalt dieses „Letter to the Editor“ nie. Trotzdem scheint er einen verhängnisvollen Umschwung eingeleitet zu haben. Obwohl nur an SpitalspatientInnen festgestellt, haben daraus viele ÄrztInnen die Annahme abgeleitet, dass Opioide weniger gefährlich als ihr Ruf seien und auch die Herstellerfirmen intensivierten nun ihre Bemühungen, ÄrztInnen und PatientInnen von der angeblichen Sicherheit ihrer Produkte zu überzeugen (9). Kürzlich haben kanadische AutorInnen die Zitationsrate dieses Letters analysiert (10): er wurde über 600-mal zitiert und das meistens falsch, nämlich als Beweis angesehen, dass Opioide nur selten zu einer Sucht führen, und es wurde nicht darauf hingewiesen, dass nur von hospitalisierten PatientInnen die Rede war. Vielmehr wurde sogar der Schluss gezogen, dass selbst bei PatientInnen mit Rückenschmerzen und Arthritis kein Suchtrisiko bei Langzeitgabe von Opioiden bestehe. Eine zweite Zitationsspitze des Letters entstand 15 Jahre später (!), 1995, als die erste Langzeitformulierung eines Opioids, nämlich des Oxycodons, auf den amerikanischen Markt kam. Als Vergleich zogen die kanadischen AutorInnen übrigens mehrere „Letters to the Editor“ heran, die unmittelbar davor und danach, also allesamt ebenfalls im Jahr 1980, erschienen sind; diese wurden im Median bloß elfmal zitiert.
Diese Zahlen sprechen keinesfalls für eine auch nur annähernd vorschriftsmäßige Anwendung von Opioiden (s.u.). Im Gegenteil, ein Opioid scheint in den USA bei allen möglichen Arten von Schmerzen verschrieben zu werden (wie Zahn- oder Rückenschmerzen, postoperativ und posttraumatisch außerhalb des Spitals) und das bereits als erstes Mittel, d.h. ohne zuerst ein nicht-opioides Analgetikum zu versuchen (11). Ein – i.d.R. stark wirksames – Opioid wird gleich zu Beginn zu hoch dosiert, sodass die verschreibenden ÄrztInnen sicher sein können, dass zumindest eine rasche Linderung oder völlige Aufhebung der Schmerzen gewährleistet ist. Das Opioid wird ohne fixen Zeitplan, sondern vielmehr bei Bedarf eingenommen (Kupierung des Schmerzes), und das offenbar so lange, bis nicht mehr die Schmerzen, sondern die Entzugssymptome den Bedarf determinieren. Die Folge ist ein rasches Abgleiten in die Abhängigkeit: die Dosis wird in immer kürzeren Abständen erhöht, dann die Verabreichung von oral auf parenteral, bisweilen auch auf inhalativ, umgestellt, um eine schnellere Anflutung ins Gehirn – und damit einen „Kick“ – zu erreichen, oft verbunden mit einem Wechsel auf ein dafür geeigneteres Opioid. Abdriften vieler SchmerzpatientInnen in die Drogenszene ist die Folge.
Besondere Bedeutung als Todesdroge hat seit drei Jahren das synthetische Opioid Fentanyl (1), von dem es zwischenzeitlich zahlreiche illegal hergestellte Varianten gibt. Dessen hundertfach höhere Potenz als Morphin und der rasche Eintritt ins Gehirn machen es extrem gefährlich, insbesondere weil es am Schwarzmarkt gern mit Heroin gemischt wird und das Verhältnis der beiden Stoffe dabei stark variiert (12).
Drei für das amerikanische Gesundheitssystem spezifische Gründe sind für den Missbrauch von Schmerzmitteln wesentlich: (a) die – in Europa verbotene – Laienwerbung auch für verschreibungspflichtige Arzneimittel, die gerade für Opioide besonders verharmlosend und aggressiv ist. Purdue Pharmaceuticals, ein Hersteller von Oxycodon, wurde wegen solcher Werbemaßnahmen bereits 2007 mit USD 634 Mio. zu einer der höchsten Geldstrafen verurteilt, die je ein Pharmaunternehmen leisten musste (es waren 90% des seit Einsetzen der irreführenden Werbung erzielten Gewinns; 13), und ist im Vorjahr aus denselben Gründen wieder verklagt worden (14), (b) es herrscht große Konkurrenz unter den privaten Krankenversicherungen, die für 50% der amerikanischen Gesundheitsausgaben aufkommen und damit auch entscheidend den Verdienst der ÄrztInnen bestimmen. Diese wollen daher ihre PatientInnen vor allem schmerzfrei wissen und negieren anscheinend jede Regel für eine korrekte Opioidverschreibung, und (c) im Gegensatz zu den strengen Bestimmungen in Europa gibt es in den USA keine Langzeitkontrolle für SchmerzpatientInnen, oft nicht einmal eine Nachkontrolle, und PatientInnen können sich mehrere „refills“ aus den Apotheken holen. Anfang 2016 traten zwar strengere Regeln in Kraft (15), sind bis jetzt allerdings noch ohne Erfolg.
Auch in den EU-Staaten, inklusive Österreich, ist der Opioidkonsum während der letzten Jahre deutlich gestiegen (16). Zwei Erklärungen sind dafür maßgebend: (a) auch die Substitutionstherapie mit Methadon oder Morphin ist gleichzeitig gestiegen; (b) die Zurückhaltung von ÄrztInnen, bei TumorpatientInnen und in der Palliativmedizin Opioide zu verschreiben, hat abgenommen. Dass kein Gesundheitsnotstand aufgrund von Abhängigkeit wie in den USA zu befürchten sei, wird von Seiten der deutschen (17) und der österreichischen Gesellschaften für Schmerzmedizin betont (18). Auch ist in den letzten zwölf Jahren die Zahl der durch ein Opioid bedingten Drogentoten nicht angestiegen (19). Eine bundesweite Umfrage bei chronischen SchmerzpatientInnen in Deutschland weist sogar auf eine noch immer bestehende Unterversorgung von PatientInnen mit Tumorschmerzen hin (20) und die Situation in Österreich wird ähnlich beurteilt (18).
Kriterien für die Schmerzbekämpfung mit Opioiden
Die akute Schmerztherapie mit Opioiden (postoperativ, posttraumatisch, bei Herzinfarkt) ist dem stationären Bereich vorbehalten. Bei chronischen Schmerzen sind Tumorschmerzen und die Palliativmedizin das dominierende Einsatzgebiet. Für andere chronische Schmerzen, wie Osteoarthrose, neuropathische, Gelenk- und Rückenschmerzen, gelten die bereits in Pharmainfo XVIII/2/2003 und XXIII/3/2008 genannten Einschränkungen, nämlich (a) wenn eine ausreichende Analgesie auf Nichtopioid-Basis – bei gleichzeitig adjuvanter Therapie (Antiepileptika, Antidepressiva) – nicht erreicht werden kann oder (b) im Einzelfall mit schweren Nebenwirkungen verbunden ist, wobei (c) das Opioid immer in retardierter Arzneiform zu verabreichen ist.
Bei Tumorschmerzen gilt die bereits in Pharmainfo VIII/1/1993 genannte Regel „by the ladder, by the mouth, by the clock“, wenn auch zwischenzeitlich neue Substanzen und Verabreichungsarten hinzugekommen sind.
By the ladder: im Rahmen eines Stufenplans kommen als erste Stufe nicht-opioide Schmerzmittel zur Anwendung, in einer zweiten Stufe – bei weiter bestehenden Schmerzen – schwach wirksame Opioide, wie Dihydrocodein (Codidol, Dehace) oder Tramadol (Tramal, Generika), i.d.R. als Ergänzung. Erst in einer dritten Stufe wird auf stark wirksame Opioide zurückgegriffen. Dazu zählen orale Zubereitungen von Morphin (Mundidol, Vendal), Hydromorphon (Hydal, Generika) und Oxycodon (Oxycontin, Generika). Als transdermales Pflaster eignet sich Fentanyl (Pharmainfo XIII/4/1998, Durogesic, Generika). Bei weiterbestehenden sehr starken Schmerzen entsprechend der ersten Stufe wird oft sofort auf die dritte Stufe übergegangen. Wenn notwendig, wird in jeder Stufe auch adjuvant behandelt (s.o.). Das ebenfalls angebotene Buprenorphin-Pflaster (Transtec, Generika) ist für eine chronische Schmerztherapie weniger geeignet, denn der Wirkstoff hat als partieller Agonist am µ-Opioidrezeptor einen Ceiling Effect, sodass eine weitere Dosiserhöhung keinen zusätzlichen Effekt bringt und auch bei einem Wechsel auf ein anderes Opioid keine rasche Wirkungssteigerung erreicht wird (s. Pharmainfo XVIII/4/2003).
By the clock and by the mouth: Opioidtherapie nur bei Bedarf ist möglichst zu vermeiden, sie kommt einem „Kick“ gleich und fördert so die Suchtentstehung! Vielmehr sollte kontinuierliche Schmerzfreiheit angestrebt werden. Nach Auftitrieren bis zur Schmerzkontrolle sollte die tägliche Dosis dann nach einem fixen Zeitplan beibehalten werden. Zur langsamen Anflutung ins Gehirn und zur Verhinderung zu großer Blutspiegelschwankungen, und damit eines Wechsels zwischen Schmerzfreiheit und Schmerzen, wird das Opioid immer oral und in retardierter Arzneiform verabreicht. Nur für die orale Auftitration werden „immediate release“ Präparate verwendet, die für Morphin (Morapid, Oramorph, Vendal) sowie auch für die oben genannten Arzneispezialitäten von Tramadol (Tramal, Generika), Hydromorphon (Hydal) und Oxycodon (Oxynorm, Generika) zur Verfügung stehen. Sollte es trotzdem zu einer Schmerzphase kommen („Durchbruchschmerz“), wird diese mit einem „immediate release“-Opioid bekämpft. Ist eine orale Gabe generell nicht möglich (Schluckbeschwerden, schwer behandelbare Obstipation) oder sollen die Blutspiegelschwankungen möglichst klein gehalten werden, eignet sich Fentanyl als transdermales Pflaster. In einigen Ländern, u.a. in Österreich, gibt es Fentanyl auch als Sublingual- bzw. Buccaltabletten (Vellofent Sublingualtabletten, Breakyl Buccalfilm, Effentora Buccaltabletten, Actiq Lutschtabletten), in den USA ist es zusätzlich als Nasenspray zugelassen. Mit der sublingualen bzw. intranasalen Resorption wird Schmerzhemmung durch rasche Anflutung innerhalb von 15 – 30 Minuten erreicht, die – in Zusammenhang mit der starken Wirksamkeit von Fentanyl – auch bei der Behandlung von Durchbruchschmerzen problematisch bezüglich einer Suchtentwicklung erscheint. Es geht aus mehreren Studien hervor (21), dass bei Einhaltung der genannten Kautelen das Risiko einer Suchtentwicklung gering ist.
Literatur
(1) NIDA, Overdose death rates, https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-death-rates(2) https://www.cdc.gov/drugoverdose/epidemic/index.html
(3) Rudd RA et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 65, 1445, 2016 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm655051e1.htm
(4) Kolodny A et al. Annual Rev Public Health 36, 559, 2015
(5) www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/
Final_Report_Draft_11-1-2017.pdf
(6) Larue F et al. Brit Med J 310, 1034, 1995
(7) Cleeland CS et al. New Engl J Med 330, 592, 1994
(8) Porter J, Jick H. New Engl J Med 302, 123, 1980
(9) U.S. News, May 31, 2017, https://www.usnews.com/news/business/articles/ 2017-05-31/painful-words-how-a-1980-letter-fueled-the-opioid-epidemic
(10) Leung PTM et al. New Engl J Med 376, 2194, 2017
(11) Daubresse M et al. Med Care 51, 870, 2013
(12) Headquarters News, March 18, 2015, US Drug Enforcement Administration https://www.dea.gov/divisions/hq/2015/hq031815.shtml
(13) http://www.domain-b.com/industry/pharma/2007/ 20070722_purdue_pharma.html
(14) Raymond N. Reuters, September 28, 2017, https://www.reuters.com/article/us-washington-opioids/washington-state-sues-oxycontin-maker-purdue-pharma-idUSKCN1C32LM
(15) Dowell D et al. MMWR Recommendation Report, https://www.cdc.gov/ mmwr/volumes/65/rr/rr6501e1.htm#contribAff
(16) International Narcotics Control Board, Report 2016, pp. 88–97
(17) http://dgschmerzmedizin.de/download/presse/ 2017/PM_Opioidabhaengigkeit_DGS_311017.pdf
(18) http://www.oesg.at/index.php?eID=dumpFile&t= f&f=508&token=386dde2bd96e6c35e59180fb477f541c18b636d7
(19) Gesundheit Österreich GmbH, Epidemiologiebericht Sucht 2017
(20) http://dgschmerzmedizin.de/download/presse/ 2017/Pressemitteilung_DGS_Ergebnisse%20PUT_Mannheim_12102017.pdf
(21) Freye E, Opioide in der Medizin, Springer, Berlin 2008, 125–168
Antizytokintherapie bei Atherosklerose – Beginn einer neuen Ära?
Viele präklinische und klinische Untersuchungen haben gezeigt, dass Atherosklerose eine entzündliche Erkrankung der Gefäße ist, zu deren Progression verschiedene Immunzellen (wie Makrophagen), Immunbotenstoffe (Zytokine, Prostaglandine, Chemokine) und möglicherweise auch infektiöse Trigger exogener und endogener Natur beitragen. Eine erhöhte Entzündungsaktivität ist, abgesehen von den klassischen Risikofaktoren für Atherosklerose wie Rauchen, Bluthochdruck, Dyslipidämie etc., mit Progression der Atherosklerose und erhöhter Morbidität und Mortalität, vor allem in Hinblick auf Schlaganfallrisiko und Myokardinfarkt assoziiert (1). Ein zentral in die immun-mediierte Pathophysiologie der Atherosklerose eingebundenes Zytokin ist Interleukin-1-ß (IL-1ß) (2). In einer randomisierten doppelblinden multizentrischen Studie wurde untersucht, ob eine durch Antikörper vermittelte Inhibition der IL-1ß Wirkung in über 10.000 PatientInnen mit vorangegangenem Myokardinfarkt und erhöhten Entzündungszeichen (gemessen an einem erhöhten hsCRP-Wert) einen klinischen Benefit bringt (3). Als Therapeutikum wurde Canakinumab, ein humaner monoklonaler Antikörper, der IL-1ß bindet und neutralisiert, in drei unterschiedlichen Dosierungen (50, 150, und 300 mg) verwendet. Canakinumab (Ilaris) wurde bereits erfolgreich zur Behandlung von IL-1 getriggerten autoimmunologischen Erkrankungen, wie z.B. Juveniler Systemischer Arthritis, verwendet (2,4).
Die PatientInnen erhielten alle 3 Monate subcutan Canakinumab bzw. Placebo für insgesamt 48 Monate, eine Nachbeobachtung erfolgte im Mittel bis zu 3,7 Jahren nach Therapiebeginn. Unter Canakinumab kam es dosisabhängig zu einer signifikanten Reduktion der CRP-Werte, allerdings ohne Effekt auf die Lipidspiegel. Der primäre Endpunkt, nämlich nicht-fataler Herzinfarkt, nicht-fataler Schlaganfall oder kardiovaskulärer Tod, fand sich bei 4,5 von 100 PatientInnen in der Placebogruppe, 4,11 von 100 in der 50 mg-Gruppe, 3,86 von 100 Personen in der 150 mg-Gruppe und 3,9 von 100 Personen in der 300 mg-Gruppe, was einer signifikanten Reduktion des primären Endpunktes für die zwei höheren Dosierungen von Canakinumab (HR 0,74; p = 0,021 für 150 mg bzw. HR 0,86; p = 0,031 bei 300 mg) entsprach. Die 150 mg-Dosierung reduzierte auch den sekundären Endpunkt, Hospitalisierung für instabile Angina pectoris (HR 0,83; p = 0,0005 im Vergleich zu Placebo). Wohl aufgrund der Inhibition eines wesentlichen Immunweges kam es unter Canakinumab zu einem leichten Anstieg von Infektionen, der aber nur bei Cellulitis signifikant war. Interessanterweise zeigte sich keine vermehrte Tumorinzidenz, allerdings bei einer nur relativ kurzen Beobachtungsphase von im Schnitt 3,7 Jahren. Demgegenüber kam es überraschenderweise unter Canakinumab-Therapie zu einer signifikanten Reduktion fataler Tumorerkrankungen. Dies wurde in einer weiteren Studie analysiert (5). Dabei zeigte sich, dass PatientInnen mit einem erhöhten hsCRP und Interleukin-6-Werten im Serum bei Studieneinschluss häufiger Lungenkarzinome entwickelten, aber unter Canakinumab-Therapie eine reduzierte Tumor-assoziierte Mortalität aufwiesen (HR 0,23; p = 0,002), allerdings häufiger an Infektionen verstarben. Der positive Effekt von Canakinumab auf das Tumor- und Gesamtüberleben der TumorpatientInnen war dosisabhängig (5).
Auch wenn die erzielten Effekte von Canakinumab auf die Reduktion kardiovaskulärer Events bei PatientInnen mit vorhergehenden Myokard-Infarkten noch eher bescheiden aussehen, zeigt diese Studie doch eindrucksvoll, dass die Modulierung des Inflammationsstatus und dadurch der Entzündungsaktivität in den Gefäßen einen positiven Einfluss auf die Progression der Atherosklerose und akute kardiovaskuläre Ereignisse ausübt. Der Benefit in Hinblick auf kardiovaskuläre Endpunkte war bei jenen PatientInnen mit der größten Reduktion des CRP-Wertes am deutlichsten (6).
Künftige Studien müssen zeigen, ob die Gabe von IL1ß-Antagonisten positive Langzeitdaten bei PatientInnen mit kardiovaskulären Erkrankungen liefert, welche PatientInnen primär von dieser Therapie profitieren, und ob auch Immuninterventionen mit anderen Biologika vergleichbare therapeutische Effekte auf Atherosklerose-bedingte Erkrankungen und Todesursachen ausüben.
Literatur
(1) Libby P. Arterioscler Thromb Vasc Biol 32, 2045, 2012
(2) Dinarello CA. Mol Med 20, Suppl 1, S43, 2014
(3) Ridker PM et al. New Engl J Med 377, 1119, 2017
(4) Ruperto N et al. New Engl J Med 367, 2396, 2012
(5) Ridker PM et al. Lancet 390, 1833, 2017
(6) Ridker PM et al. Lancet 391, 319, 2018
Mikronisiertes Dehydroepiandrosteron (DHEA) zur postmenopausalen Hormontherapie
Eine interessierte Kollegin bittet um Auskunft zu folgender Frage: „Ist es tatsächlich sinnvoll, dem Rat der Befürworter bioidenter Hormone zu folgen und nur noch mikronisiertes DHEA zu verschreiben, oder kann auch weiterhin DHEA in der "Normalform" gegeben werden". Diese Frage spiegelt die Tatsache wider, dass zunehmend Präparate mit mikronisiertem DHEA für die Therapie postmenopausaler Beschwerden propagiert werden. Hintergrund ist die etwas bessere orale Bioverfügbarkeit mikronisierter Zubereitungen, wobei zusätzliche Effekte, wie Verminderung des hepatischen Metabolismus und verminderte Konversion zu Testosteron im Vergleich zu nicht-mikronisierten Präparaten postuliert werden (1, 2). Für die Verbesserung der oralen Bioverfügbarkeit stünden heute jedoch wesentlich effizientere galenische Verfahren zur Verfügung. Medizinisch relevante pharmakokinetische Vergleichsstudien für mikronisierte Präparate finden sich nicht. Die North American Menopause Society rät von der Verwendung von magistral hergestellten oder wenig qualitätskontrollierten Hormonpräparaten, wie DHEA, ab, da damit eine reproduzierbare Dosierung nicht garantiert werden kann (3).
Wir haben in der Pharmainfo XVIII/3/2003 (DHEA – Viel Lärm um nichts?) über DHEA (auch: Prasteron) kritisch berichtet und festgestellt, dass für seine Anwendung als Anti-Aging-Mittel keine solide Evidenz existiert. DHEA (und sein Sulfatester) ist als sog. "Jungbrunnenhormon" bekannt. Entsprechend zahlreich sind verlockende Angebote für rezeptfreie DHEA-Supplemente im Internet. Häufig postulierte Wirkungen, wie Verbesserung von Gedächtnis und körperlichem Wohlbefinden bei älteren Menschen oder gar lebensverlängernde Wirkungen wurden bisher in prospektiven klinischen Studien immer noch nicht nachgewiesen (4). Langzeitsicherheit und genaue Dosierung bei oraler Gabe, einschließlich des Vergleichs mikronisierter Präparate mit Standardzubereitungen, sind nicht ausreichend gesichert (4–6).
DHEA ist ein vor allem in der Nebennierenrinde gebildetes schwach wirksames Androgen, welches als Prohormon bzw. Zwischenprodukt in der Androgen- und Östrogensynthese angesehen werden kann. Bei Frauen dient es ebenfalls als Vorstufe für Testosteron. Seine Produktion, und somit auch die von Testosteron, nimmt kontinuierlich bis zur Menopause mit dem Alter ab, was für das Auftreten altersbedingter Beschwerden verantwortlich gemacht wird. Eine Korrelation von Plasmaandrogenspiegeln mit der weiblichen Sexualfunktion ist jedoch nicht ausgeprägt (7). Wie bei gesunden Männern ist altersbedingter Androgenmangel auch bei gesunden Frauen nicht als behandlungsbedürftige Erkrankung anzusehen (Endocrine Society 2014, 6). Kleinere Studien sprechen dafür, dass bei Nebenniereninsuffizienz bei ausgewählten PatientInnen bei adäquater Substitution von Gluco- und Mineralocorticoiden eine zusätzliche Androgenersatztherapie (vorzugsweise durch Testosteron, aber auch DHEA; 8–10) zur Verbesserung der Lebensqualität, wenngleich nicht routinemäßig, erwogen werden kann. Wirksam ist DHEA zur intravaginalen Therapie von Symptomen vulvovaginaler Atrophie (11–13). Für die Indikation Dyspareunie wurde ein DHEA-Präparat vor kurzem in den USA zugelassen und auch seitens der EMA wurde dafür 2017 eine Zulassungempfehlung ausgesprochen (Prasteron: Intrarosa). Ein Vorteil gegenüber Östradiol- (13) oder Östriol-haltigen Vaginaltabletten ist allerdings nicht erkennbar.
Zur Therapie von postmenopausalen Östrogenmangelsymptomen ist in Österreich ein DHEA-Präparat zugelassen, allerdings nur in fixer Kombination mit Östradiol in einer Depot-Fertigspritze (Gynodian). Dieses Präparat muss bei Frauen mit erhaltenem Uterus mit Gestagenen kombiniert werden. Für eine Monotherapie peri- oder postmenopausaler Symptome mit DHEA existiert derzeit keine solide Evidenz. So spricht sich eine Task Force von US und europäischen Fachgesellschaften (6) gegen die Anwendung von DHEA bei postmenopausalen Frauen mit normaler Nebennierenfunktion aus. DHEA hat weniger günstige Effekte auf Surrogatparameter wie die Knochendichte (Frakturdaten liegen nicht vor, 14) und das Lipidprofil (senkt HDL-Cholesterin) als Östrogene mit günstigen Frakturendpunkten). Jüngste Metaanalysen fanden keine signifikanten bzw. klinisch relevanten positiven Effekte auf Libido, Sexualfunktion, Lebensqualität oder andere Parameter (5, 14).
Zusammenfassung: Aus den vorliegenden klinischen Daten ergibt sich kein erkennbarer therapeutischer Nutzen für die orale DHEA-Behandlung von Beschwerden der Frau in der Peri- und Postmenopause. Ein Vorteil gegenüber zugelassenen Hormonpräparaten (die mit entsprechend strenger Indikationsstellung verordnet werden sollten, siehe Pharmainfo XXXI/1/2016) ist nicht belegt. Für die lokale intravaginale Anwendung bei vulvovaginalen Beschwerden stehen bei uns qualitätskontrollierte Östrogenpräparate zur Verfügung. Ausreichende Daten zur Sicherheit einer mehrjährigen Hormontherapie (z.B. kardiovaskuläres oder Brust- und Eierstockkrebsrisiko) mit DHEA fehlen.
Die Frage der interessierten Kollegin ist daher so zu beantworten, dass derzeit die orale Gabe von DHEA, unabhängig von der gewählten Formulierung, keinen erkennbaren therapeutischen Stellenwert hat.
Literatur
(1) Casson PR. Am J Obstet Gyn 174, 649, 1996
(2) Buster JE. Am J Obstet Gyn 166, 1163, 1992
(3) The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause 24, 728, 2017
(4) Genazzani AR. Climacteric 13, 314, 2010
(5) Scheffers CS. Cochrane Database Syst Rev 1, CD011066, 2015
(6) Wiermann ME. J Clin Endocrinol Metab 99, 3489, 2014
(7) Davis SR. JAMA 294, 91, 2005
(8) Miller KK. J Clin Endocrinol Metab 91, 1683, 2006
(9) Hunt PJ. J Clin Endocrinol Metab 85, 4650, 2000
(10) Alkatib AA. J Clin Endocrinol Metab 94, 3676, 2009
(11) Archer DF. Menopause 22, 950, 2015
(12) Labrie F. Menopause 23, 243, 2016
(13) Archer DF. J Steroid Biochem Mol Biol 174, 1, 2017
(14) Elraiyah T. J Clin Endocrinol Metab 99, 3536, 2014
P.b.b. Erscheinungsort Verlagspostamt 1010 Wien
Montag, 5. März 2018



