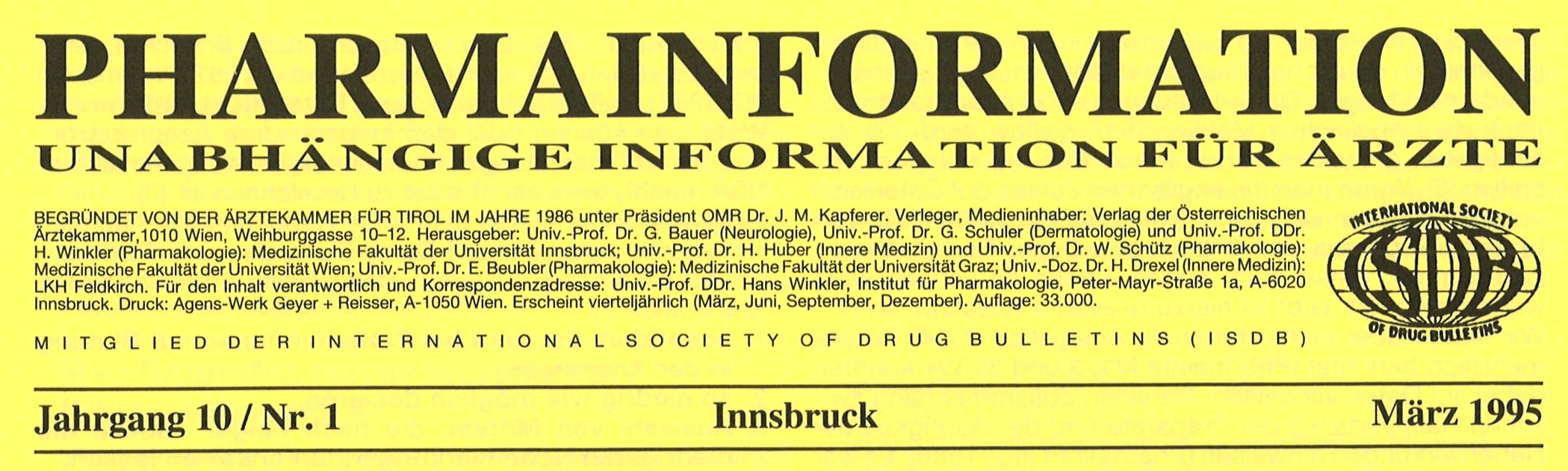
Inhalt
- Magen-Darm-Blutungen durch NSA
- Chirale Pharmaka z.B. S(+)Ibuprofen
- Vitamine zur Krebsprävention
- Schmerzbekämpfung bei Krebspatienten
Editorial
Die Pharmainformation geht in das 10. Jahr. Nach kleinem Beginn im Rahmen der Tiroler Ärztekammer mit einer Auflage von 1.000 Stück, haben die Ärztekammern von einem Bundesland nach dem anderen, die Pharmainformation übernommen. Seit 1994 trägt die Österreichische Ärztekammer diese Publikation mit einer gesamtösterreichischen Auflage von 33.000. Die Redaktion der Pharmainformation wird von Mitgliedern aller drei Medizinischen Fakultäten Österreichs geführt. Als einzige österreichische Publikation sind wir Mitglied der International "Society of Drug Bulletins", die es sich zur Aufgabe gemacht hat, unabhängig und kritisch über Arzneimittel zu berichten. Wir geben anschließend einige Beispiele (Zusammenfassungen, wo notwendig übersetzt), wie ausländische Zeitschriften (alles Mitglieder dieser Society) kritisch über Medikamente berichten. All diese Zeitschriften aber betonen, so wie das auch die Pharmainformation neben aller Kritik tut, welche positiven Fortschritte am Arzneimittelmarkt gemacht werden.
In der nächsten Nummer werden wir berichten, welche Substanzen, die wir im Laufe der ersten 10 Jahre kritisierten, vom Markt verschwunden sind, wo unser früheres Urteil vielleicht ein wenig zu kritisch war oder wo sich eine noch positivere Entwicklung als ursprünglich angenommen gezeigt hat.
Drug and Therapeutic Bulletin (31,18, 1993) England
Fluorochinolon Antibiotica:
"Die Fluorochinolon Antibiotica (z.B. Ciproxin, Gyramid, Peflacine, Tarivid) sind gegen einen weiten Bereich von gramnegativen Bakterien bakterizid wirksam; sie sind weniger effektiv gegen grampositive Bakterien. Einzelne Vertreter sind gut etabliert als erste Wahl-Antibiotika bei komplizierten Harnwegsentzündungen, akuten Entzündungen bei zystischer Fibrose, invasiver Salmonellose, maligner Otitis externa, Penicillin-resistenter N. gonorrhoe Infektion und schwerer gramnegativer Sepsis. Wir können ihren Routinegebrauch für andere Indikationen wie unkomplizierte Harnwegsinfekte oder Resprirationstraktinfekte nicht empfehlen, da dies die Selektion Chinolon-resistenter Bakterien steigert und eine unnotwendig teure Option darstellt."
Pharmakritik (16, 31,1994) Schweiz
"Betahistin (Betaserc) ist ein oral verabreichbares Histamin-Analogon, das verschiedene Histaminrezeptoren besetzen kann. Es wird zur Therapie der Ménièr'schen Krankheit, aber auch bei Schwindel unspezifischer Ursache empfohlen.
In einer zwei Monate dauernden, gekreuzten Doppelblindstudie bei 35 an Morbus Ménière leidenden Patienten konnte jedoch weder in der subjektiven noch in der objektiven Beurteilung ein signifikanter Unterschied zwischen Betahistin (2mal täglich 24 mg in Retardform) und Placebo nachgewiesen werden (Acta otolaryng. 1992, Suppl. 497, 9-181). Die Autoren dieser Studie analysierten 52 weitere klinische Betahistin-Studien. Nur drei Studien erfüllten nach ihrer Meinung die Anforderungen an ein gutes Studiendesign. Sie schließen deshalb, daß für Betahistin bisher kein eindeutiger Wirkungsnachweis vorliege. Die wichtigsten Nebenwirkungen von Betahistin sind Kopfschmerzen, Müdigkeit und gastrointestinale Beschwerden."
Prescrire International (2, 117, 1993) Frankreich
Etodolac (Lodine): a "me too" NSAID.
"Zweimal 300 mg Etodolac Tabletten täglich sind effektiv in der Behandlung akuter Attacken von Ostearthritis, aber die Nutzen/Risiko Ratio ist nicht besser als bei anderen nicht steroidalen Antiphlogistica (NSAID). Die aufgrund von endoskopischen Kriterien behaupteten Vorteile von Etodolax gegenüber anderen NSAID Substanzen, die auf endoskopischen Kriterien basieren, haben keine klinische Relevanz.
Arzneimittelbrief (28, 3,1994) Deutschland
Eine Anfrage bezüglich der Wirksamkeit von Bakterienpräparaten (Mutaflor, Symbioflor) zur "Sanierung der Darmflora" wird so (gekürzt) beantwortet: "Bei beiden Spezialitäten handelt es sich um Bakterienpräparate. Mutaflor enthält vermehrungsfähige E.-coli-Stämme, Symbioflor 2 enthält Zellen und Autolysat von humanen E.-coli-Stämmen, Symbioflor 1 enthält Zellen und Autosylat von humanen Enterococcus-faecalis-Stämmen.
Nach unserer Kenntnis ist die Gabe dieser Bakterienpräparate bei den oben genannten Indikationen nicht eindeutig durch kontrollierte Prüfungen belegt. Auch für den theoretischen Ansatz einer Beeinflussung dieser Erkrankungen durch eine solche Therapie gibt es bisher keine gesicherten naturwissenschaftlichen Belege. Ob überhaupt durch die Einnahme von Bakterien ein Einfluß auf die Darmflora genommen werden kann, ist ebenfalls umstritten. Bei der rezidivierenden pseudomembranösen Kolitis (antibiotikaassoziierte Kolitis) liegen zwar anekdotische Berichte über die Wirksamkeit von Saccharomyces boulardii (Hefepilz) vor;größere kontrollierte Studien stehen aber noch aus.
Magen-Darm-Blutungen durch nicht-steroidale Antiphlogistica
Wirksame Arzneimittel haben nahezu zwangsläufig Nebenwirkungen. Bestrebungen, diese zu vermeiden, sollten vor allem dort ansetzen, wo Nebenwirkungen rein quantitativ gesehen, ein deutliches Problem darstellen. Dies gilt insbesondere für Magen-Darm-Blutungen und Perforationen, die nach dem englischen Meldesystem (yellow card) die am häufigsten gemeldete Gruppe von Nebenwirkungen darstellen (3). Wenn man die englischen Zahlen auf Österreich umrechnet, dann sind bei uns pro Jahr ca. 1.500 Fälle von blutenden Ulcera und 300 Magen-Darm-Perforationen zu erwarten. Diese doch hohen Zahlen zu senken wäre wünschenswert. Gibt es hierzu relevante Ansatzpunkte?
Wir haben über nicht-steroidale Analgetica (NSA) bereits mehrfach berichtet (Pharmainfo II/1/1987, Pharmainfo II/2/1987 und Pharmainfo II/3/1987). Wir konnten dabei auf Daten verweisen, die einen Zusammenhang zwischen Halbwertzeit der Präparate und der Häufigkeit der Nebenwirkungen hinweisen (Pharmainfo III/2/1988). Es war aber damals schwierig, eindeutige Feststellungen zu machen, weil die Daten zum Teil unvollständig und widersprüchlich waren (siehe z.B. Lancet (1) für frühere Studien). Zwei große englische Studien dürften die Situation nun doch klarer gemacht haben (1,2), auch wenn weiterhin auf einem so wichtigen Gebiet einige Unklarheiten verbleiben (3). Die folgende Tabelle gibt im Anschluß an die Präparate die jeweilige Halbwertszeit (HWZ) an. Säule II gibt an, wie viele schwere Nebenwirkungen pro 1 Mio Verschreibungen aufgetreten sind (siehe Pharmainfo III/2/1988). Säule III gibt das relative Risiko an, eine gastrointestinale Blutung oder Perforation unter Medikation zu erleiden, wie sie in der einen Studie (2) gefunden wurden und Spalte IV das relative Risiko einer Ulcusblutung von der zweiten Studie. Spalte V (1) gibt schließlich an, wie die Präparate nach den Meldungen in England nach den ersten 5 Jahren nach Markteinführung bezüglich Nebenwirkungen zu reihen sind (3).
| I (HWZ) | II | III | IV | V | |
| Ibuprofen (Brufen) | (1-2) | 13,2 | 2,9 | 2,0 | 1 |
| Diclofenac (Präparate sieheText) | (1-2) | 39,4 | 3,9 | 4,2 | 2 |
| Ketoprofen (Profenid) | (1-2) | 38,6 | 5,4 | 23,7 | 6 |
| Indomethacin (Präparate siehe Text) | (4) | - | 6,3 | 11,9 | - |
| Flurbiprofen (Froben) | (4) | 35,8 | - | - | - |
| Diflusinal (Fluniget) | (10) | 47,2 | - | - | - |
| Naproxen (Proxen) | (14) | 41,1 | 3,1 | 9,1 | 5 |
| Fenbufen (Lederfen) | (15) | 69,4 | - | - | - |
| Sulindac (Clinoril) | (18) | 54,3 | - | - | - |
| Azapropazon (Prolixan) | (20) | 87,9 | 23,4 | 31,5 | 12 |
| Piroxicam (Felden) | (35) | 68,1 | 18,0 | 13,7 | 11 |
Die Daten sprechen eigentlich für sich selbst. Die Übereinstimmung zwischen den Studien ist relativ gut, nur bei Ketoprofen ist eine Diskrepanz festzustellen, da es in einer Studie (IV) relativ toxisch erscheint. Übereinstimmend zeigt sich, daß eine lange Halbwertszeit mit stärker werdender Nebenwirkungsfrequenzeinhergeht, während Präparate mit kurzer Halbwertszeit, wie Ibuprofen (Brufen), Diclofenac (Tratul, Dedolor, Deflamat, Diclobene, Diclofenac, Diclomelan, Diclosyl, Fenaren, Maglophen, Naclof, Voltaren) und Indomethacin (Flexidin, Indocid, Gaurit, Indocin, Indohexal, Indomelan, Indometacin "Genericon", Indoptol, Indo-Tablinen, Luiflex, Ralicid) und auch Naproxen relativ günstig liegen. Eine besonders durchgehende und kaum unterbrochene Hemmung der Prostaglandinsynthese ist vermutlich, z.B. für die Magenschleimhaut, besonders schädlich. Da erhöhte Toxizität zumindest zum Teil mit der langen Halbwertszeit zusammenhängt ist anzunehmen, daß auch Tenoxicam (Liman "Kali", Tilcotil) mit der längsten Halbwertszeit von 70 Stunden durch erhöhte Toxizität belastet sein dürfte. Hierzu liegen leider keine publizierten Daten vor, Zurückhaltung gegenüber dieser Substanz, besonders bei chronischer Verwendung, erscheint zumindest derzeit aber angebracht (vgl. auch Pharmainfo III/4/1988).
Die eine englische Studie (2) belegt auch noch einmal das an sich zu erwartende Phänomen, daß Patienten mit Magenblutung in der Anamnese ein besonders hohes Nebenwirkungsrisiko für NSA haben. Weiters zeigte sich auch zumindest bei einzelnen Substanzen, wieder nicht überraschend, daß eine Dosiserhöhung vermehrt Nebenwirkungen auslöst.
Für Piroxicam (Felden) und Azapropazon (Prolixan) kann man feststellen (vgl. auch Pharmainfo II/3/1987; Pharmainfo II/2/1987), daß sie aufgrund dieser Datennicht Mittel erster Wahl sein können oder daß insbesonders Azapropazon, das auch 50mal häufiger Photosensibili-sierung als andere NSA macht, wohl als obsolet zu bezeichnen ist (3).
Aufgrund dieser Daten kann eine Reduktion der häufigen Nebenwirkungen (Magen-Darm-Blutungen und Perforation) bei NSA durch folgende Maßnahmen erreicht werden (siehe auch 3):
1. Besondere Vorsicht bei Patienten/innen mit Blutung in der Anamnese
2. So niedrig wie möglich dosieren.
3. Auswahl von Mitteln, die nach obiger Tabelle die niedrigsten Nebenwirkungsraten erwarten lassen.
Literatur:
(1) Lancet 343, 1075, 1994
(2) Lancet 343, 769, 1994
(3) Lancet 343, 1051, 1994
(4) Arzneitelegramm 7, 66, 1994
Chirale Pharmaka am Beispiel des S(+)-Ibuprofens
Über chirale Präparate wird derzeit sogar in der Laienpresse einiges geschrieben. Was bringen diese Präparate wirklich, stellen sie einen wesentlichen Fortschritt dar oder sind sie mehr pharmakologisch interessant als klinisch relevant?
Chiralität
Unter Chiralität versteht man die Spiegelbildlichkeit von Figuren und Molekülen. Zwei spiegelbildliche Formen eines Moleküls, sogenannte optische Isomere (syn. Enantiomere), drehen die Schwingungsebene polarisierten Lichtes in entgegengesetzte Richtungen und treten immer dann auf, wenn das Molekül ein oder mehrere asymmetrische(s) C-Atom(e) besitzt. Bei Drehung im Uhrzeigersinn (Rechtsdrehung) wird dem Molekülen ein (+), bei Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn (Linksdrehung) ein (-) vorangestellt. Aus Sicht der Prioritätenfolge am asymmetrischen C-Atom erfolgt auch eine Unterteilung in R (rectus) und S (sinister). Liegen die beiden Enantiomere hingegen zu gleichen Teilen vor, so kompensiert sich der Drehwert der Ebene des polarisierten Lichtes auf (a) = 0; wir sprechen von einem Racemat (benannt nach (+/-)-acidum racemicum, Traubensäure).
In der Natur vorkommende Stoffe liegen in der Regel optisch rein vor, da Biosynthesen asymmetrisch verlaufen. Beispiel sind Aminosäuren, Glucose oder Morphin, das 5 asymmetrische C-Atome besitzt. Bei herkömmlichen, im Labor durchgeführten Synthesen entstehen hingegen meist Racemate, und viele Pharmaka werden in dieser Form auch therapeutisch eingesetzt. Da eine Interaktion mit biologischen Zielstrukturen, wie Rezeptoren oder Enzymen, oft stereoselektiv verläuft, ist daher auch keine idente Wirksamkeit der in einem Racemat 1:1 vorliegenden Enantiomeren zu erwarten. Die Antipoden besitzen zumeist aber auch qualitativ unterschiedliche, bisweilen sogar entgegengesetzte Wirkungen (1). So besitzt vom ß-Blocker Sotalol (Sotacor) nur das (-) Enantiomer eine ß-blockierende Wirkung, beide Enantiomere hemmen hingegenden den repolarisierenden K+-Ausstrom und wirken demnach als Klasse III-Antiarrhythmika (siehe Pharmainfo IX/3/1994). Vom Klasse Ic-Antiarrhythmikum Propafenon (Rytmonorma, Asonacor, Propafenon "Genericon") wiederum bewirken beide Enantiomere eine vergleichbare Hemmung von Na+-Kanälen, dessen S(+)-Enantiomer besitzt aber zusätzlich ß-blockierende Wirkung. Aber gerade der oxidative Abbau dieses S-Enantiomers ist bei 7% der europäischen Bevölkerung stark verlangsamt (poor metabolizer-Phänotyp), bedingt durch einen genetischen Polymorphismus an einem Cytochrom P-450-Enzym (2). Insgesamt sind über ein Drittel der weltweit synthetischen Arzneimittel chiral. Dabei soll sich der Arzt aber der Problematik bewußt sein, daß er möglicherweise zwei völlig unterschiedlich wirksame Stoffe vor sich hat. Selten ist nämlich ausschließlich das für die Wirksamkeit relevante Enantiomer verfügbar. Das liegt im aufwendigen Syntheseverfahren begründet, obgleich moderne chemische und biotechnologische Techniken heute bereits enantioselektive Synthesen, aber auch die Trennung vorhandener Racemate erlauben (3). Eine rezente Neuentwicklung auf diesem Sektor stellt das nicht-steriodale Antirheumatikum Ibuprofen dar, das in Österreich als derzeit einzigem Land auch in Form des optisch reinen S(+)-Ibuprofens (Dexibuprofen: Seractil) verfügbar ist.
S(+)-Ibuprofen versus racemischen R/S(+/-)-Ibuprofen
Nicht-steroidale Antirheumatica sind großteils achirale Substanzen. Eine Ausnahme bilden die Aryl- und Heteroarylpropionsäurederivate. Dazu gehören Ibuprofen (Brufen, Avallone, Dismenol, Dolgit, Ibuprofen "Biochemie", Ibuprofen "Genericon", Ibuprofen "Lannacher", Ibuprofen "Sanabo", Imbun, Junifen, Nurofen, Urem), Naproxen (Proxen, Miranax), Flurbiprofen (Froben), Ketoprofen (Profenid), Fenoprofen (Nalfon) und Pirprofen (Rengasil); einzig Fenbufen (Lederfen) ist achiral. Mit Ausnahme von Naproxen, das immer schon sterisch rein in Form des rechtsdrehenden Isomers angeboten wird, liegen die anderen Verbindungen als Racemate vor. Das (zumindest in Deutschland) meistverordnete Produkt dieser Gruppe, Ibuprofen (4), wird nun seit Jahresbeginn auch als reines S(+)-Enantiomer (Dexibuprofen: Seractil) angeboten.
S(+)-Ibuprofen stellt im racemischen Ibuprofen die wirksame Komponente dar, da die Hemmung der Prostaglandin-Synthese, der für die Wirksamkeit verantwortliche molekulare Mechanismus, durch S-(+)Ibuprofen mit 100-200-fach niedrigeren Konzentrationen erreicht wird als durch R(-)-Ibuprofen (5-7). Wie unterschiedlich Racemate allerdings zu beurteilen sind, geht daraus hervor, daß bei einem anderen Antirheumaticum dieser Gruppe, dem Flurbiprofen, beide Enantiomeren - wenn auch über unterschiedliche Mechanismen - zur Wirksamkeit beitragen (8). Beim R/S(+/-)-Ibuprofen selbst findet in vivo eine unidirektionale Inversion der unwirksamen R(-)- zur wirksamen S(+)-Form statt, die etwa 30% ausmacht (9-11). Die Umwandlung erfolgt allerdings protrahiert, trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, daß ein Teil der Wirkung des Racemates indirekt auch durch R(-)-Ibuprofen vermittelt wird. Eine in vivo-Inversion ist aber naturgemäß großen intra- und interindividuellen Schwankungen unterworfen und kann dadurch die Dosiseinstellung beträchtlich erschweren (7). Gerade bei den extrem häufig und leider meist auch chronisch angewandten nicht-steroidalen Antirheumatica, die in einem hohen Maß Ursache von Arzneimittelkrankheiten darstellen, wäre daher ein Präparat wie die reine S-(+)-Form von Ibuprofen, mit dem Höhe und Verlauf der Serumspiegel exakter vorhersehbar sind, zumindest theoretisch einem razemischen Gemisch vorzuziehen. Außerdem läuft die Inversion über die Zwischenstufe eines Coenzym A-Thioesters, der Hybridester mit Triglyceriden bilden kann. Diese Speicherung im Fettgewebe kann zu Kumulation verbunden mit unerwünscht langer Halbwertszeit führen (12).
Es ist allerdings kaum zu erwarten, daß aufgrund einer Dosiseinsparung von S(+)-Ibuprofen im Vergleich zu racemischen Ibuprofen auch weniger häufig und weniger ausgeprägt unerwünschte Wirkungen auftreten. Es sind ja typische Nebenwirkungen, wie gastrointestinale Reaktionen und Nierenfunktionsstörungen Folge der Prostaglandinsynthese-Hemmung durch die wirksame S(+)-Form. Die wenigen kontrollierten Studien, die publiziert sind, haben nur eine geringe Aussagekraft. Bei einem direkten Vergleich von S(+)-Ibuprofen und Racemat, wobei die Dosis der S(+)-Form einmal 50% (13) und einmal 2/3 des Racemates betrug (14), wurden zwar ähnliche Wirksamkeit und Verträglichkeit gefunden, für eine definitive Aussage war die Patientenzahl in beiden Studien aber zu gering; eine der beiden Studien (13) war auch nicht verblindet und bezog sich auf einen viel zu heterogenen Indikationskreis (schmerzhafte Affektionen im Rahmen des rheumatischen Formenkreises).
Schlußfolgerung: Die Verabreichung des wirksamen Enantiomers S(+)-Ibuprofen anstelle von racemischen R/S(+/-)-Ibuprofen besitzt die zumindest theoretischen Vorteile einer Dosiseinsparung, einer geringeren Stoffwechselbelastung und der fehlenden Inversion der R-(-)- zur S-(+)-Form. Letztere ist aufgrund individueller Schwankungen unerwünscht, da im Einzelfall nicht vorhersehbar. Diese Vorteile dürften aber entsprechend den derzeit vorliegenden Daten mit keiner klinisch relevanten Reduzierung unerwünschter Wirkungen verbunden sein.
Literatur:
(1) Eur. J . Clin. Pharmacol. 26, 663, 1984
(2) New Engl. J. Med. 322, 518, 1990
(3) SCRIP 16, 1993 (February)
(4) Arzneiverordnungsreport 93, Gustav Fischer, Stuttgart
(5) J. Pharm. Pharmacol. 28, 256, 1976
(6) Prostaglandins 10, 59, 1975
(7) Biochem. Pharmacol. 37, 105, 1988
(8) J. Clin. Pharmacol. 32, 944, 1992
(9) Eur. J. Clin. Pharmacol. 38, 493, 1990
(10) Chirality 3, 418, 1991
(11) Ther. Drug Monitoring 14, 464, 1992
(12) Biochem. Pharmacol. 35, 3405, 1986
(13) Lancet 339, 681, 1992
(14) Rheumatol. Int. 11, 199, 1991
Vitamine
Vitamine zur Krebsprävention
Wir haben bereits mehrfach über Studien berichtet, die Wirkungen von Vitamingaben belegten oder bisherige Behauptungen über solche Wirkungen widerlegten. So konnten mehrere Studien überzeugende Daten dafür liefern, daß Folsäuregabe zur Prävention von Neuraldefekten in der Schwangerschaft geeignet ist (Pharmainfo VIII/2/1993 und siehe unten). Andererseits hatte Vitaminzufuhr keinen Effekt auf die Schulleistung von Kindern (Pharmainfo V/4/1990). Mangelnde Zufuhr von Vitamin E in der Nahrung kann möglicherweise die Herzinfarktrate erhöhen (Pharmainfo VIII/4/1993). Möglicherweise deshalb, weil in dieser Studie nur retrospektive Daten ausgewertet wurden, und nicht prospektiv eine Zuweisung von Patienten in verschiedene Untergruppen (z.B. Verum versus Placebo) erfolgte.Prospektive Studien haben eine höhere Verläßlichkeit, weil unbekannte Zusatzfaktoren ausgeschaltet werden können.
Den Vitaminen A, C und E wurde immer wieder eine wichtige Rolle in der Krebsprävention zugeschrieben. Langzeitstudien an einer großen Fallzahl machen nun zum ersten Male eine verläßliche Aussage möglich. In einer Studie (1) wurden 89.494 Frauen seit 1980 bezüglich Vitaminzufuhr (A, C und E) und Brustkrebshäufigkeit untersucht. Für Vitamin C war die Brustkrebshäufigkeit unabhängig davon, ob die Patientinnen eine tägliche Zufuhr von weniger als 93 mg bis über 1300 mg aus der Nahrung bzw. von zusätzlichen Vitamingaben hatten. Auch für Vitamin E (von weniger als 4 IE bis über 600 IE) war kein präventiver Effekt zu sehen. Für Vitamin A hatte die Untergruppe (20% der Patientinnen), die am wenigsten Vitamin A mit der Nahrung einnahmen, ein um 20% erhöhtes Krebsrisiko. Nur in dieser Gruppe reduzierte die zusätzliche Gabe von Vitamin A Präparaten das Krebsrisiko. Diese Studie widerlegt also das Konzept, daß Vitamin C und E generell das Krebsrisiko reduzieren, und zeigt auf, daß höchstens Patientinnen mit einem Vitamin A-Mangel ein geringfügig erhöhtes Brustkrebsrisiko haben. Ein solches Vitamindefizit tritt aber bei normaler Ernährung gar nicht auf.
Eine zweite Studie unter ganz anderen Voraussetzungen brachte ebenfalls überzeugende Daten gegen eine Krebsprävention durch Vitamingabe (2). Über 8 Jahre wurden 29.133 Raucher (Alter 50 - 69 Jahre) in Finnland entweder mit Placebo oder Vitamin A (ß Karotin: 20 mg ) oder Vitamin E (alpha-Tocopherol: 50 mg) oder mit beiden Vitaminen behandelt. Die Lungenkrebshäufigkeit (Inzidenz per 10.000) betrug 47 in der Placebo-Gruppe, 48 in der Vitamin E-, 57 in der Vitamin A- und 55 in der A, E-Gruppe. Es war also kein präventiver Effekt der Vitamine zu erfassen, für Vitamin A wurde sogar eine geringfügige Erhöhung der Inzidenz beobachtet. Interessant waren aber auch zusätzliche Ergebnisse für andere Parameter einschließlich der Mortalität. Vitamin E senkte zwar die Prostatakrebshäufigkeit (minus 34%), dafür wurden aber andere Krebsformen erhöht. Auch geringfügig weniger Herztodesfälle waren zu verzeichnen, dafür stiegen die hämorrhagischen Schlaganfälle an. Diese Schwankungen mögen zufallsbedingt sein. Auf jeden Fall war die Gesamtmortalität nach Vitamin E um 2% höher, nach Vitamin A-Gabe sogar 8%. Eine entscheidende Wirkung von Vitamin E auf Herztodesfälle (möglicherweise angedeutet durch eine retrospektive Studie wie oben erwähnt und in Pharmainfo VIII/4/1993 diskutiert), erscheint daher eher in Frage gestellt. Diese Studie zeigt eindrucksvoll, daß weder Vitamin A noch E das Lungenkrebsrisiko reduzieren. Möglicherweise hat diese Vitaminzufuhr sogar im gesamten gesehen negative Effekte.
In einer dritten Studie (864 Patienten) wurde der Effekt einer 4-jährigen Supplementierung mit beta-Carotin, Vitamin C und Vitamin E auf das Auftreten von Adenomen des Colons untersucht (3). Die Vitamingabe hatte keinen präventiven Effekt. Da Adenome eine Vorstufe für Karzinome darstellen können, unterstützt auch diese Studie nicht eine vorbeugende Wirkung von Vitaminen bei Darmkrebs. Daten, die für einen günstigen Effekt einer Diät von Gemüse und Obst für diese Erkrankung sprechen, sind daher wohl nicht durch die dadurch erfolgte Vitaminzufuhr, sondern durch andere Faktoren (Fasergehalt oder Reduktion von Fleisch- und Fettzufuhr) zu erklären.
Zusammenfassend können wir feststellen: Drei große Studien haben überzeugend dargelegt, daß sich für Vitamin A-, C- und E-Gabe keine Krebspräventionbelegen läßt. Es erscheint daher zweckmäßig, Patienten/innen entsprechend aufzuklären, um ihnen unnötige Kosten zu ersparen. Dies heißt natürlich keineswegs, daß eine ausgewogene Ernähung mit den notwendigen Vitaminen zu vernachlässigen ist, sondern nur daß zusätzliche Vitamingabe zur Krebsprävention offensichtlich nicht sinnvoll ist. Rauchern/ Raucherinnen muß immer wieder klar gemacht werden, daß das Krebsrisiko nicht durch irgendwelche Vitamine oder Medikamente sondern nur durch das Aufgeben des Rauchens reduziert werden kann. Die "Vitaminbefürworter" werden diese Studien kritisieren und haben bereits damit begonnen (4). Nur überzeugende neue Daten von prospektiven Studien könnten aber diese klar negativen Befunde widerlegen.
Literatur:
(1) New Engl. J. Med. 329, 234, 1993
(2) New Engl. J. Med. 330, 1029, 1994
(3) New Engl. J. Med. 331, 141, 1994
(4) Veris Vitamin E News Letter, April 1994
Folsäure zur Prävention von Neuralrohrdefekten
Wir haben darüber berichtet, daß die Gabe von Folsäure zum Zeitpunkt der Konzeption und am Beginn der Schwangerschaft zu einer deutlichen Reduktion (bis zu 70%) von Neuralrohrdefekten bei Föten führen kann (Pharmainfo VIII/2/1993). Für Frauen, die bereits eine Schwangerschaft mit einem Kind mit Neuralrohrdefekt hatten, ist das Risiko auch in einer zweiten das gleiche Problem zu haben 1 zu 25, während für andere Frauen dieses nur 1 zu 250 (siehe Drug & Therapeutic Bulletin 32,31,1994) ist. Offensichtlich ist daher eine Gabe von Folsäure mit der relativ hohen Dosis von 5 mg (Folsan-Tabletten: 5 mg, von der Konzeption bis zur 12. Schwangerschaftswoche) für die ersteren Frauen zwingend. Epilepsie Patientinnen unter Valproal (Convulex, Depakine, Ergenyl, Leptilanil) und Carbamazepin (Neurotop, Sirtal, Tegretal) haben ebenfalls ein erhöhtes Risiko ein Kind mit Neuralrohrdefekt zu bekommen. Für diese Frauen ist eine Folsäureprophylaxe daher ebenfalls notwendig. Mit der obigen Prophylaxe kann man aber nicht die Neuralrohrdefekte erfassen, die bei den Frauen zum ersten Mal auftreten und den Großteil (95%) dieser Mißbildung ausmachen. Aufgrund der vorliegenden Studien ist es daher empfehlenswert, allen Frauen die schwanger werden wollen, Folsäure zu geben (eine kleine Dosis von ca. 0,5 mg reicht hierzu aus: von der Konzeption bis zu 12. Schwangerschaftswoche). Für diese niedrige Dosis gibt es nicht einmal theoretische Bedenken für das Auftreten von Nebeneffekten und es bleibt daher nur der mögliche Nutzen der Prävention dieser relativ häufigen Mißbildung. In Österreich gibt es derzeit kein Folsäuremonopräparat mit dieser niederen Dosis.
Schmerzbekämpfung bei Krebspatienten
Wir haben bereits in der Pharmainfo VIII/1/1993 über die international (z.B. WHO) empfohlene Vorgangsweise bei der Schmerzbekämpfung von Krebspatienten berichtet: by the mouth, by the clock and by the ladder, also oral in fixen Zeitabständen gegebene Analgetika, je nach Bedarf ansteigend aus der Gruppe I (wichtigste Mittel: Acetylsalicylsäure (Acimetten, Aspirin, Aspro, Acidum Acetylosalicylicum, ASS); Ibuprofen (Avallone, Brufen, Dolgit, Ibuprofen, Imbun, Nurofen) Naproxen (Proxen); Diclofenac (Deflamat, Diclofenac, Diclobene, Dicloclan, Fenaren, Magluphen, Tratul, Voltaren), der Gruppe II (wichtigstes Mittel: retardiertes Dihydrocodein bitartrat: Codidol) und der Gruppe III (wichtigstes Mittel retardiertes Morphin: Mundidol, Vendal retard). Wir hatten auch festgestellt, daß mehrere Studien und Berichte belegen, daß in Österreich, so wie in anderen Ländern, Krebspatienten immer wieder zu wenig Analgetikaerhalten.
Eine gründliche amerikanische Studie (New Engl. J. Med. 330,592,1994) bestätigt dies nun von neuem und gibt auch einige interessante zusätzliche Details. Von 597 in der Studie untersuchten Patienten/innen mit Carcinom-Rezidiven oder Metastasen hatten 250 (!), also 42%, zu wenig Analgetika erhalten. Diese 250 Patienten hatten daher unnötige Schmerzen, die stark genug waren, ihre Funktionen (wie Gehen, Stimmung und Lebensqualität) deutlich zu beeinträchtigen. Schlechter als der Durchschnitt, also zu wenig Analgetika erhielten insbesondere Frauen, Patienten/innen über 70 Jahre und ethnische Minderheiten(Schwarze und Spanisch-stämmige). Ein entscheidender Faktor war auch, daß bei diesen unterbehandelten Patienten/innen die Einschätzung über das Schmerzausmaß durch die Ärzte sich deutlich von der durch die Patienten/innen unterschied. Auch waren 14% der Ärzte grundsätzlich gegen Opiate, 30% stellten fest, daß sie hochwirksame Analgetika den Patienten/innen erst geben würden, wenn diese nur mehr eine Lebenserwartung von 6 Monaten hätten.
Auch in Österreich müssen wir uns daher immer wieder fragen: Behandeln wir Krebspatienten nach etablierten Richtlinien, also je nach Schwere der Schmerzen bis zur Arzneimittelgruppe 3 (Morphin)? Ist uns klar, daß der Patient den Schmerz verspürt und daher seine Einschätzung unabhängig von seiner Lebenserwartung entscheidend ist? Gibt es Untergruppen bei unseren Patienten/innen (Frauen, über 70jährige, Gastarbeiter), die auch bei uns eher unterbehandelt werden?
Das Recht auf ausreichende Schmerzbekämpfung ist ein wichtiges Menschenrecht!
P.b.b. Erscheinungsort Verlagspostamt 1010 Wien
Donnerstag, 10. April 1995
Pharmainformation
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.



