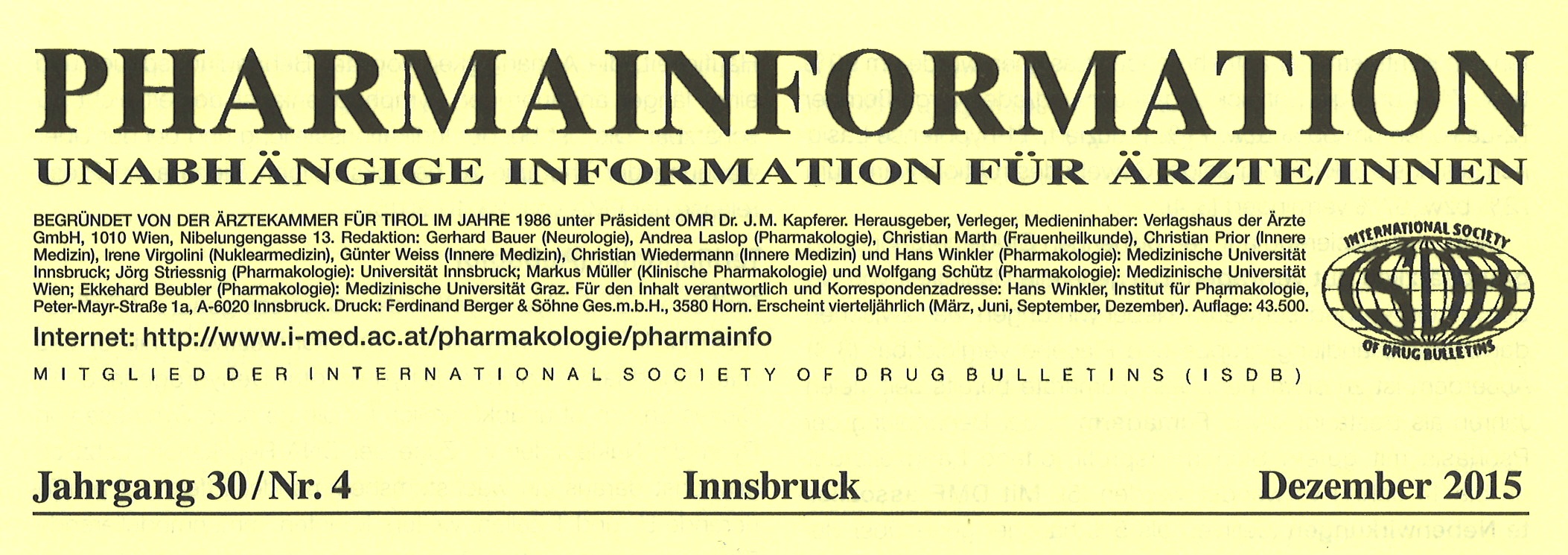
Inhalt
- Update Blase: Anticholinergika, Mirabegron (Betmiga)
- SSRI und Schwangerschaft
- Diclofenac versus Naproxen
- Prävention Vorhofflimmern
- E-Zigaretten
Neue immunmodulierende Therapien der Multiplen Sklerose
Harald Hegen, Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Universität Innsbruck
Die Multiple Sklerose (MS) ist eine chronische, entzündlich-demyelinisierende und im Spätstadium degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems und stellt die häufigste neurologische Krankheit junger Erwachsener mit dem Risiko für eine spätere permanente Behinderung dar. Die MS beginnt typischerweise zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr, zeigt eine Prädominanz für Frauen (ca. 70%) und nimmt in 85% der Fälle einen schubförmigen Verlauf, der durch das Auftreten neurologischer Störungen (Schübe) und deren Rückbildung gekennzeichnet ist (schubförmig-remittierende MS, RRMS); der erste Schub wird als klinisch isoliertes Syndrom (CIS) bezeichnet. Nach ca. 15-25 Jahren konvertieren unbehandelt die meisten der RRMS-PatientInnen zum sekundär-chronisch progredienten Verlauf (SPMS), welcher durch akkumulierende neurologische Behinderung charakterisiert ist. In 15% der PatientInnen ist die Erkrankung durch eine von Beginn an progrediente Verlaufsform (ohne Auftreten von Schüben) gekennzeichnet (primär progrediente MS, PPMS).
In der Pharmainfo XXVII/4/2012 wurde zuletzt die Basis- und Eskalationstherapie der MS besprochen. In den letzten zwei Jahren sind vier neue immunmodulierende Medikamente zur Behandlung der RRMS in Europa zugelassen worden. Die jeweilige Indikation, Wirkung sowie das Nebenwirkungsprofil, letzteres erfordert häufig auch ein spezifisches Therapie-Monitoring, sollen nachfolgend im Sinne einer Risiko-Nutzen-Überlegung im Kontext der gegenwärtigen Therapielandschaft kritisch beleuchtet werden.
Für die klinische Bewertung der MS-Therapien durch Studien werden üblicherweise die jährliche Schubrate (d.h. die durchschnittliche Anzahl der Schübe pro Jahr) als auch die Behinderungsprogression verwendet. Letztere beruht auf der relativ komplexen Expanded Disability Status Scale (EDSS) mit Bewertungen von 0 bis 10. Ein Score von 0 Punkten entspricht einem/r subjektiv beschwerdefreien und klinisch neurologisch unauffälligen Patienten/in, beispielsweise 2 Punkte spiegeln eine geringe Beeinträchtigung wider (z.B. Parese Kraftgrad 4 in einer oder zwei Muskelgruppen), 4 Punkte können eine eingeschränkte Gehstrecke unter 500 Meter und 6 Punkte die Verwendung einer Gehhilfe bedeuten, 7 Punkte zeigen etwa eine/n Rollstuhl-gebundene/n Patienten/in. In den Studien spricht man grundsätzlich von einer Zunahme der Behinderung, wenn der EDSS-Score für die Dauer von 3 bis 6 Monaten (je nach Studie) um mindestens 0,5 - 1 Punkte [je nach Ausgangswert (aufgrund der Nicht-Linearität der Skala)] angestiegen ist.
Dimethylfumarat (Tecfidera)
Dimethylfumarat (DMF) ist ein Fumarsäureester, der rasch (im Darm) zum wirksamen Metaboliten Monomethylfumarat (MMF) hydrolysiert wird. MMF verhindert einerseits den Abbau von Nuclear Factor E2-related factor 2 (Nrf2), der anti-oxidative und zytoprotektive Proteine induziert (z.B. NQO1, HO-1), und hemmt andererseits den Transkriptionsfaktor NF-κB, der in inflammatorische Prozesse involviert ist (1). Das Rationale dieses Wirkmechanismus ist, dass in der Pathogenese der MS neben Inflammation auch oxidativer Stress als wesentlicher Trigger vor allem der axonalen Degeneration gesehen wird (2).
Seit Jänner 2014 ist DMF von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zur Behandlung von erwachsenen PatientInnen mit schubförmig-remittierender MS zugelassen. DMF wird als Kapsel à 240 mg zweimal täglich per os (p.o.) verabreicht.
Die klinische Wirksamkeit von DMF wurde in zwei randomisierten, doppelblinden, placebo-kontrollierten Phase III-Studien - DEFINE („Determination of the Efficacy and Safety of Oral Fumarate In Relapsing-Remitting MS“) und CONFIRM („Comparator and an Oral Fumarate in RRMS“) - an über 2600 RRMS-PatientInnen über einen Zeitraum von zwei Jahren nachgewiesen. DMF zeigte (in der DEFINE und CONFIRM Studie in der zugelassenen Dosierung) eine relative Reduktion der Schubrate um 53% bzw. 44% gegenüber Placebo (es trat hierbei eine Reduktion der durchschnittlichen jährlichen Schubrate von 0,36-0,40 auf 0,22-0,17 ein, oder anders ausgedrückt würde ein/e Patient/in unter Therapie einen neuerlichen Schub erst nach 5 Jahren erleiden, während dies unter Placebo bereits nach 2,5 Jahren der Fall wäre). Zudem konnte eine relative Reduktion der Behinderungsprogression um 38% bzw. 21% beobachtet werden. Laut EPAR (European Public Assessment Report), EMA (London), wurde der Unterschied in Hinblick auf Behinderungsprogression allerdings als nicht robust eingeschätzt, da der Signifikanzlevel nur in einer der beiden Studien erreicht wurde.
Ein positives Ergebnis war (in beiden Studien) auch in Hinblick auf verschiedene MRT-Parameter zu verzeichnen, die als Surrogatmarker für die Krankheitsaktivität gelten: Das Auftreten von Kontrastmittel-aufnehmenden Läsionen wurde um 90% bzw. 74% und die Entwicklung neuer und/oder vergrößernder T2 Läsionen um 85% bzw. 71% reduziert; T1 hypotense Läsionen (als Ausdruck höhergradiger Gewebsdestruktion) waren um 72% bzw. 57% vermindert (3,4).
DMF wird basierend auf den bisherigen Studienergebnissen grundsätzlich gut vertragen. Die generelle Häufigkeit von Nebenwirkungen und schweren Nebenwirkungen war zwischen der DMF-Behandlungsgruppe und Placebo vergleichbar (3,4). Außerdem ist zu erwähnen, dass Fumarate bereits seit vielen Jahren als Bestandteil von Fumaderm in der Behandlung der Psoriasis mit gutem Sicherheitsprofil (offene Langzeitstudien bis 14 Jahre) verwendet werden (5). Mit DMF assoziierte Nebenwirkungen (definiert als 5% häufiger gegenüber der Placebogruppe) waren Flushing (ca. 34%) und gastrointestinale Beschwerden (Diarrhoe ca. 14%, Übelkeit ca. 12%, Oberbauchschmerzen ca. 10%). Beide Nebenwirkungen traten mehrheitlich transient, typischerweise im 1. Behandlungsmonat auf, und wurden überwiegend als mild bis moderat eingestuft (3,4). Diesbezüglich wird (gemäß Fachinformation) eine einschleichende Dosierung empfohlen (DMF 120 mg 2x täglich p.o. für die ersten 7 Tage). In der DMF-Behandlungsgruppe wurde keine erhöhte Rate von Infektionen oder Neoplasien beobachtet. Laborchemisch war einerseits eine klinisch nicht wirksame Erhöhung der Transaminasen und andererseits ein Absinken der Leukozyten und Lymphozyten zu verzeichnen (um etwa 11% bzw. 30%), wobei deren absolute Zahl mehrheitlich innerhalb des Referenzwertes blieb; eine Lymphopenie <0,5x109 trat in ca. 5% der Fälle auf, war allerdings nicht mit höherer Häufigkeit von Infektionen vergesellschaftet (3,4). Regelmäßige Kontrollen sowohl der Leberfunktionsparameter als auch des Blutbilds sind empfohlen (siehe Fachinformation).
Ein tödlich verlaufener Fall von progressiver multifokaler Leukencephalopathie (PML) ist 2014 bei einem MS-Patienten in Deutschland aufgetreten, der über einen Zeitraum von 4,5 Jahren mit DMF behandelt wurde und bei dem über mehr als 3,5 Jahre eine ausgeprägte Lymphopenie (mehrheitlich <0,5x109) bestanden hat (6). Ein weiterer Fall ebenfalls mit deutlicher Lymphopenie wurde kürzlich berichtet (7). In der Behandlung der MS-PatientInnen mit DMF sind dies die ersten Fälle von PML, einer Infektionserkrankung des Gehirns verursacht durch eine (Re-)Aktivierung des JC (John Cunningham)-Virus, eine schwere Nebenwirkung, die bei der MS bislang nur im Zuge der Therapie mit Natalizumab (Tysabri) bekannt war.
Fumarsäurepräparate (z.B. Fumaderm) sind in der Behandlung der Psoriasis schon länger in Verwendung. Bei dieser Erkrankung wurde auch ein PML-Fall mit geringgradiger (> 724 x 109) Lymphophenie berichtet (8, siehe auch 8a).
Insgesamt sind derzeit beim Deutschen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bereits 9 Verdachtsfälle im Rahmen der Psoriasisbehandlung registriert (8b).
Die vorliegenden Daten sprechen dafür, dass es unter der Behandlung mit Fumarsäurederivaten zum Auftreten von PML kommen kann. Über die Häufigkeit, die Abhängigkeit von der Behandlungsdauer und inwieweit Lymphophenie ein Risikofaktor ist, können derzeit keine verlässlichen Aussagen getroffen werden.
Zusammenfassung
Bislang liegen keine direkten Vergleichsstudien von Tecfidera mit den Basistherapeutika vor,eine ähnliche Wirksamkeit dürfte aber gegeben sein. Ein Vorteil für die PatientInnen ist die orale Gabe. Tecfidera wird insgesamt relativ gut vertragen. Allerdings ist festzustellen, dass einzelne PML Fälle bei der Behandlung mit Fumarsäurederivaten aufgetreten sind. Die Häufigkeit, die Abhängigkeit von der Behandlungsdauer und einer länger andauernden Lymphophenie ist derzeit nicht abschätzbar. Dies ist bei der Indikationsstellung und bei der Überwachung der Therapie zu berücksichtigen (siehe auch Press-release der EMA vom 23.10.2015).
Teriflunomid (Aubagio)
Teriflunomid (2-Hydroxyethyliden-Cyanessigsäure-4-Trifluormethylanilid) ist ein reversibler, nicht-kompetitiver Inhibitor des mitochondrialen Enzyms Dihydroorotat-Dehydrogenase (9). Dieses Enzym ist unabkömmlich für die de novo-Synthese von Pyrimidin-Nukleotiden im Zuge der DNA-Replikation. Letztlich erwächst daraus ein wachstumshemmender Effekt auf proliferierende B- und T-Zellen; weiters konnten immunmodulierende Effekte gezeigt werden: Reduktion von Zytokin-Produktion (10) und günstige Beeinflussung der Interaktion zwischen T-Zellen und Antigen-präsentierenden Zellen (11). Die Tatsache, dass in der Pathogenese der MS sowohl T-Zellen als auch B-Zellen eine Rolle spielen, erklärt das Rationale für den Wirkmechanismus.
Seit August 2013 ist Teriflunomid von der EMA zur Behandlung von erwachsenen PatientInnen mit schubförmig-remittierender Multipler Sklerose zugelassen. Teriflunomid wird als Filmtablette à 14 mg einmal täglich p.o. verabreicht.
Die Wirksamkeit von Teriflunomid wurde in zwei randomisierten, doppelblinden, placebo-kontrollierten Phase III-Studien - TEMSO („The Teriflunomide Multiple Sclerosis Oral“) und TOWER („Teriflunomide Oral in people with relapsing remitting Multiple Sclerosis“) - an über 2000 RRMS-PatientInnen über einen Zeitraum von zwei Jahren nachgewiesen. Teriflunomid zeigte (in der TEMSO und TOWER Studie in der zugelassenen Dosierung) gegenüber Placebo eine relative Reduktion der Schubrate um 32% bzw. 36% (d.h. die durchschnittliche jährliche Schubrate sank von 0,50-0,54 auf 0,32-0,37; anders ausgedrückt würde ein/e Patient/in unter Therapie erst nach drei Jahren einen Schub erleiden, aber schon nach zwei Jahren unter Placebo). Zudem wurde eine relative Reduktion der Behinderungsprogression um 30% bzw. 31% verzeichnet (d.h. in der Placebo-Gruppe verzeichneten 27% der PatientInnen eine Zunahme des Behinderungsgrades, hingegen 20% in der Behandlungsgruppe). Das Auftreten von Kontrastmittel-aufnehmenden Läsionen wurde relativ um 80%, das Volumen von T2 Läsionen um 67% und von T1 hypotensen Läsionen um 31% reduziert (keine MRI Endpunkte in TOWER; 12,13). In einer Head-to-head Studie konnte die gleiche Effektivität von Teriflunomid gegenüber Interferon beta-1a s.c. (in Hinblick auf Zeit bis zum Auftreten eines Schubes, als auch jährlicher Schubrate) gezeigt werden (14), der Nachweis von „superiority“ ist aber nicht gegeben (EPAR, EMA).
Teriflunomid ist der aktive Metabolit von Leflunomid, ein Arzneimittel (Arava), das bereits seit ca. 15 Jahren zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis sowie der Psoriasis-Arthritis eingesetzt wird, und zu dem eine große Therapieerfahrung vorliegt (mehr als 1,9 Millionen PatientInnen-Behandlungsjahre). Gegenüber Placebo wurden in der Teriflunomid-Behandlungsgruppe häufiger Diarrhöen (ca. 15%), Übelkeit (ca. 12%) sowie eine meistens reversible, verminderte Haardichte (13%, eine nicht gefährliche Nebenwirkung, aber „ a socially debilitating side effect, particularly for female subjects:“ EPAR, EMA, London) berichtet. Laborchemisch kann eine Erhöhung der Leberwerte auftreten (>3x des oberen Grenzwertes in bis 8% der Fälle), diesbezüglich sind Laborkontrollen empfohlen (siehe Fachinformation). Es hat sich weder ein erhöhtes Risiko für opportunistische oder schwerwiegende Infektionen noch für Malignität gezeigt. Bislang sind keine PML-Fälle unter Therapie mit Teriflunomid bekannt [zwei PML-Fälle wurden in der Literatur unter der Therapie mit Leflunomid berichtet (12, 15-17)].
Besonders zu beachten ist die Teratogenität der Substanz. Teriflunomid ist als einziges MS-Therapeutikum gemäß FDA-Schwangerschafts-Risiko-Klassifizierung als Kategorie X (Evidenz von fetalen Abnormitäten in Tier oder Mensch bzw. für Risiko des Fötus basierend auf Nebenwirkungsmeldungen) eingestuft. Dementsprechend muss vor Therapiebeginn eine Schwangerschaft ausgeschlossen sein und während der Therapie eine wirksame Empfängnisverhütung durchgeführt werden. Die Kontrazeption muss (laut Fachinformation) nach Absetzen der Medikation so lange aufrecht erhalten werden, bis der Plasmaspiegel von Teriflunomid unter den potenziell teratogenen Grenzwert (0,02 mg/l) abfällt. Teriflunomid wird nur langsam aus dem Plasma eliminiert; durchschnittlich dauert es acht Monate, bis die genannte Zielplasmakonzentration erreicht wird, wobei es aufgrund individueller Unterschiede bei der Clearance der Substanz bis zu 2 Jahre dauern kann. Bei gewünschter oder eingetretener Schwangerschaft muss ein Verfahren zur beschleunigten Elimination angewendet werden (durch Verabreichen von Cholestyramin oder Aktivkohle); die Wirksamkeit der beschleunigten Elimination muss durch Kontrolle des Plasmaspiegels (2x in einem Abstand von mindestens 2 Wochen) bestätigt werden. Bei den bisher berichteten unter Therapie aufgetretenen Schwangerschaften sind unter Anwendung des beschleunigten Teriflunomid-Eliminationsverfahrens keine teratogenen Nebenwirkungen aufgetreten (18).
Zusammenfassung
Teriflunomid (Aubagio) ist insgesamt eine oral einzunehmende Alternative zu den etablierten Basistherapien, hat aber signifikante Nebenwirkungen und ist teratogen.
Alemtuzumab (Lemtrada)
Alemtuzumab ist ein rekombinanter, humanisierter, monoklonaler Antikörper, der gegen das von T- und B-Lymphozyten an der Oberfläche exprimierte Glykoprotein CD52 gerichtet ist. Nach Bindung von Alemtuzumab an CD52 kommt es zunächst zur Depletion der Lymphozyten (via Antikörper-mediierter zellulärer und Komplement-mediierter Zytotoxizität) und anschließend zur Repopulation, was eine geänderte Zahl, Verteilung und Funktion von Lymphozyten-Subpopulationen nach sich zieht, z.B. eine Erhöhung der Anteile an regulatorischen T-Zellen (19-21).
Im September 2013 wurde Alemtuzumab zur Behandlung von erwachsenen PatientInnen mit schubförmig-remittierender Multipler Sklerose mit aktiver Erkrankung, definiert durch klinischen oder bildgebenden Befund, von der EMA zugelassen. Die Zulassung war aufgrund des Nebenwirkungsprofils nicht unumstritten, so erfolgte in den USA zuerst eine Ablehnung und erst im zweiten Anlauf die Zulassung; in Europa erfolgte diese nur über ein Mehrheitsvotum (Gegenstimmen aufgrund eines „nicht positiven Nutzen-Risiko-Verhältnisses“, siehe EPAR, EMA, London).
Die Zulassung basiert auf den beiden randomisierten, kontrollierten Phase III-Studien: CARE-MS I und CARE-MS II. Basierend auf den Einschlusskriterien spiegelt die CARE-MS II am ehesten die Situation in der täglichen Routine wider (d.h. Therapieeskalation bei unzureichender Krankheitskontrolle unter Basistherapie), denn dabei handelte es sich um eher jüngere RRMS-PatientInnen, mit relativ kurzer Erkrankungsdauer (median 4 Jahre) und höherer Krankheitsaktivität (mindestens 2 Schübe in den vorangegangenen 2 Jahren; und mindestens 1 Schub im Jahr vor Studieneinschluss, davon mindestens 1 Schub unter IFN beta oder Glatirameracetat nach mindestens sechsmonatiger Therapie; 22). In dieser Studie wurde die jährliche Schubrate in der Behandlungsgruppe mit Alemtuzumab um 49 % gegenüber IFNbeta-1a s.c. verringert, die Behinderungsprogression war um 42 % niedriger. Weiters konnte die Überlegenheit von Alemtuzumab gegen IFN beta-1a s.c. in Bezug auf verschiedene MRT-Parameter gezeigt werden [Anzahl der PatientInnen mit neuen oder vergrößerten T2 Läsionen (46% vs. 68%), mit Kontrastmittel-anreichernden T1 Läsionen (9% vs. 23%); Hirnvolumen (-0,615% vs. -0,81%); 22].
Alemtuzumab wird als i.v. Infusion in zwei Behandlungsphasen verabreicht: 12 mg pro Tag, im ersten Behandlungsjahr an fünf und im zweiten Behandlungsjahr an drei aufeinanderfolgenden Tagen; danach erfolgen im Regelfall keine weiteren Verabreichungen.
Alemtuzumab weist ein Nebenwirkungsprofil auf, das eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung und, wenn die Therapie begonnen worden ist, ein engmaschiges Therapiemonitoring erfordert. In den beiden Zulassungsstudien war die Rate an Nebenwirkungen in der Alemtuzumab-Behandlungsgruppe (in der zugelassenen Dosierung) höher verglichen mit IFN beta-1a (ca. 8 vs. 5 Nebenwirkungsfälle pro PatientInnenjahr).
Bei ca. 90% der PatientInnen traten unter der Therapie mit Alemtuzumab (bis zu 24 Stunden nach der Verabreichung) leichte bis mittelschwere, sogenannte infusions-assoziierte Reaktionen (Kopfschmerzen 43%, Hautausschlag ca. 40%, Urticaria 13%, Fieber ca. 25%, Übelkeit 15%) auf (22,23), weshalb (gemäß Fachinformation) unmittelbar vor der Verabreichung von Alemtuzumab die Vorbehandlung mit Kortikosteroiden (z.B. 1.000 mg Methylprednisolon, wie in den klinischen Studien) und gegebenenfalls zusätzlich mit Antihistaminika und/oder Antipyretika erfolgen soll.
Klinisch von großer Relevanz ist das erhöhte Risiko für das Neuauftreten von Autoimmunerkrankungen. Bislang wurden Fälle von idiopathisch thrombozytopenischer Purpura (ITP, ca. 1%), autoimmuner Nephropathien (0,3%) und Immunthyreopathien (ca. 36% kumulativ über 4 Jahre) beobachtet. Die ITP trat typischerweise zwischen 14-36 Monaten nach der ersten Gabe von Alemtuzumab auf, und nahm in einem Fall einen tödlichen Verlauf (Indexfall); deshalb ist die Durchführung eines Blutbildes mit Differenzialblutbild monatlich empfohlen. Fälle von Nephropathien traten innerhalb von 39 Monaten nach der letzten Infusion auf (zwei schwere Fälle wurden früh erkannt und hatten nach Behandlung einen positiven Ausgang); das entsprechende Monitoring umfasst die Bestimmung der Nierenfunktionsparameter sowie des Harnstatus monatlich (bis 48 Monate nach der letzten Infusion). Schilddrüsenfunktionsstörungen traten mit höchster Inzidenz zwischen 24 und 42 Monaten nach Erstexposition mit Alemtuzumab auf und umfassten hypo- und hyperthyreote Stoffwechsellagen, Mb. Basedow und verringerte TSH-Blutspiegel. Die Mehrzahl der Fälle wurde als mild bis moderat eingestuft und konnte medikamentös beherrscht werden. Schwerwiegende Funktionsstörungen waren selten (<1%) und umfassten thyreotoxische Krisen und endokrine Opthalmopathie. Als Monitoring wird (gemäß Fachinformation) die Bestimmung der Schilddrüsen-Parameter alle drei Monate (bis 48 Monate nach der letzten Infusion) empfohlen.
Generell waren Infektionen unter Alemtuzumab häufiger als unter IFN beta-1a betreffend Harnwegsinfektionen, Infektionen der oberen und unteren Atemwege, Reaktivierung von Herpes Viren; diese waren meist mild bis moderat. Schwere Infektionen, z.B. Herpes zoster, Tuberkulose (-reaktivierung) traten selten auf, resultierten allerdings in einer Reihe von Empfehlungen (siehe Fachinformation). Bei allen PatientInnen ist eine orale Prophylaxe gegen Herpes-Infektionen durchzuführen (z.B. mit Aciclovir (Generika, Zovirax); am ersten Tag der Behandlungsphase mit Alemtuzumab bis mindestens 1 Monat über den Abschluss der jeweiligen Behandlungsphase hinaus). Zudem ist der Varizella zoster Virus (VZV)-Antikörper-Status bei PatientInnen ohne Impfschutz beziehungsweise ohne positive Anamnese für eine frühere Infektion vor Therapiebeginn zu erheben, um bei Negativität die Impfung (vor Therapiebeginn mit Alemtuzumab) zu erwägen. Auch ein Tuberkulose-Screening ist empfohlen. Bezüglich Aktivierung einer Hepatitis B oder C liegen keine Daten vor (da Ausschlusskriterium in den klinischen Studien), es ist aber die Testung von PatientInnen mit per sé erhöhtem Risiko für eine Hepatitis-Erkrankung in Erwägung zu ziehen.
Während der Therapie mit Alemtuzumab ist eine zuverlässige Verhütungsmethode anzuwenden. Alemtuzumab kann die Plazentaschranke überschreiten und stellt somit ein potentielles Risiko für den Fötus dar. Ob Alemtuzumab bei schwangeren Frauen zur Fruchtschädigung führen kann, ist letztlich aber unbekannt.
Zusammenfassung
Alemtuzumab ist nach sorgfältiger Risiko-Nutzen-Abwägung einzusetzen. Gemäß den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie ist Alemtuzumab zur Therapieeskalation entsprechend Zulassung („aktive Erkrankung“) empfohlen. Im Gegensatz dazu wird laut FDA aufgrund des Nebenwirkungsprofils die Verwendung von Alemtuzumab restriktiver gesehen und ist für PatientInnen reserviert, die ein unzureichendes Therapieansprechen auf zwei oder mehr MS-Therapeutika hatten.
Peginterferon beta-1a (Plegridy)
IFN beta Präparate werden seit mehr als 20 Jahren als immunmodulierende Basistherapie zur Behandlung der MS eingesetzt. IFN beta, das rekombinant in kultivierten Säugerzellen hergestellt wird, weist pleiotrope Effekte auf: einerseits reduziert es die Einwanderung von Lymphozyten in das Zentralnervensystem, andererseits werden Antigen-präsentierende Zellen und das Zytokin-Milieu günstig beeinflusst.
Seit Juli 2014 wird die Therapielandschaft der IFN beta Präparate (bisher Avonex, Betaferon und Rebif) um eine pegylierte Form (PegIFN beta) ergänzt. Plegridy, das alle 2 Wochen als subkutane Injektion verabreicht wird, kann laut EMA-Zulassung zur Behandlung von erwachsenen PatientInnen mit schubförmig-remittierender Multipler Sklerose eingesetzt werden.
IFN beta ist ein relativ kleines Protein und wird in vivo rasch eliminiert, sodass bisher eine häufige Applikation notwendig war (1x pro Woche bis jeden 2. Tag). Mit der Pegylierung von IFN beta, d.h. der Anheftung einer Polyethylenglycol (PEG)-Seitenkette an das IFN beta-Molekül, konnten die Halbwertszeit und der Wirkspiegel (area under the curve und peak concentration) verlängert werden (24). In einer randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase III-Studie (ADVANCE) wurde über einen Zeitraum von einem Jahr an über 1500 RRMS-PatientInnen die Wirksamkeit von PegIFN beta gezeigt. In der zugelassenen Dosierung wurde eine relative Reduktion der Schubrate um 36% (durchschnittliche jährliche Schubrate nahm von 0,397 auf 0,256 ab, d.h. durchschnittlich würde ein/e Patient/in unter Therapie erst nach 4 Jahren einen neuerlichen Schub, unter Placebo nach 3 Jahren entwickeln), der Behinderungsprogression um 38% (nach zwei Jahren erfuhren 10,5% der PatientInnen in der Placebo-Gruppe eine permanente Zunahme des Behinderungsgrades, hingegen 6,8% in der Behandlungsgruppe) sowie auch eine signifikante Besserung in Hinblick auf MRT-Parameter erreicht (25). Im zweiten Studienjahr, indem die PatientInnen der ursprünglichen Placebo-Gruppe re-randomisiert wurden, blieb der Therapieeffekt gegenüber der „verspäteten“ Behandlungsgruppe bestehen (26). Das Fehlen der Placebo-Gruppe im zweiten Studienjahr führte aber zur Kritik seitens der EMA, da insbesondere der Effekt auf die Behinderungsprogression nicht verlässlich gezeigt wurde - „has not been robustly shown“ (EPAR, EMA, London).
Die häufigsten Nebenwirkungen sind grippeähnliche Symptome (47%), Kopfschmerzen (44%) und lokale Reaktionen an der Einstichstelle (62%). Weitere Nebenwirkungen sind Anstieg der Transaminasen (>3x des oberen Grenzwertes in 2% der Fälle) und sehr selten eine milde Leukopenie. Die Entwicklung von neutralisierenden Antikörpern gegen IFN beta war äußerst gering (<1%; 25,26), es liegen aber noch keine Langzeitdaten vor.
Zusammenfassung
Trotz fehlender direkter Vergleichsstudien zu den bisher zugelassenen Interferon beta-Präparaten (Avonex, Betaferon, Rebif) ist von einer ähnlichen Wirksamkeit auszugehen. Die z.T. geringere Injektionsfrequenz stellt für die PatientInnen einen Vorteil dar und könnte somit auch die Compliance erhöhen.
Literatur
(1) Semin Neurol 33,56,2013
(2) Nat Med 17,495,2011
(3) NEJM 367,1098,2012
(4) NEJM 367,1087,2012
(5) Br J Dermatol 149,363,2003
(6) NEJM 368,1657,2013
(7) NEJM 372,1476,2015
(8) NEJM 372,1474,2015
(8a) Neur Neuroimmun Neuroinf 2,e85,2015
(8b) Bull Arzneimittelsicherheit Ausgabe 3,Sept 2015
(9) Biochem Pharmacol 50,861,1995
(10) J Immunol 159,167,1997
(11) Arthritis Rheum 52,2730,2005
(12) NEJM 365,1293,2011
(13) Lancet Neurol 13,247,2014
(14) Mult Scler 20,705,2014
(15) Ann Rheum Dis 62,50,2003
(16) Autoimmun Rev 8,144,2008
(17) Arch Neurol 65,1538,2008
(18) ECTRIMS 2012,P737
(19) Eur J Immunol 35,3332,2005
(20) J Clin Invest 119,2052,2009
(21) J Clin Immunol 30,99,2010
(22) Lancet 380,1829,2012
(23) Lancet 380,1819,2012
(24) J Clin Pharmacol 52,798,2012
(25) Lancet Neurol 13,657,2014
(26) Mult Scler 21, 1025, 2015
Update: Überaktive Blase:
Neu: Mirabegron (Betmiga)
Wir konzentrieren uns hier auf die medikamentöse Therapie und nicht auf Maßnahmen wie Blasen- und Beckenbodentraining (1. Wahl: 1).
Anticholinergika (auch Antimuscarinica genannt)
Bei der ersten Besprechung im Jahre 1994 (Pharmainfo IX/1) von Oxybutynin (Generika, Ditropan) haben wir festgestellt, dass einer relativ geringen Wirkung auf die Blaseninkontinenz häufige Nebenwirkungen gegenüberstehen. Heute sind in Österreich folgende Präparate registriert: Oxybutynin, Darifenacin (Emselex), Fesoterodin (Toviaz), Propiverin (Mictonorm), Solifenacin (Vesicare), Tolterodin (Generika, Detrusitol, Santizor) und Trospium (Inkontan, Spasmolyt, Spasmo-Urgenin, Urivesc).
Gibt es zwischen diesen Präparaten klinisch relevante Unterschiede in Wirkung und Nebenwirkungen?
Wirkung: Um die klinische Wirkung festzustellen werden als ein Parameter meist die Reduktion der (Drang-)Inkontinenzepisoden pro Tag bestimmt. In einer typischen Studie (siehe z.B. Pharmainfo XXI/4/2006) sanken diese von 5 Episoden nach einem Anticholinergikum um 2,8, aber mit Placebo auch bereits um 2,1, was nur eine Differenz von 0,7 Episoden pro Tag ergibt. Ein solcher, nicht sehr beeindruckender Effekt ist typisch für Anticholinergika wie eine Meta-Analyse von 94 randomisierten Studien (2) zeigt: „Overall drugs for urinary incontinence showed similar small benefit“ (weniger als 20% zusätzliche Reduktion versus Placebo: siehe auch 3). Über diese Bewertung scheint Konsens zu bestehen (siehe Guideline der Eur. Ass. of Urology: 1): „there is no consistent evidence that one antimuscarinic drug is superior“.
Nebenwirkungen: Vor allem anticholinerge Effekte wie Mundtrockenheit (im Mittel bei 30% der PatientInnen: 4), Obstipation und Akkomodationsstörungen sind häufig und sind neben einer relativ schwachen Wirkung ein Hauptgrund für Therapieabbrüche; nach 3 Monaten trifft dies, wie eine Studie aus England zeigt, bereits für 50 – 60% und nach 12 Monaten für 70 - 80% der PatientInnen zu (5).
Auch bezüglich Nebenwirkungen sind die Präparate trotz zahlreicher Versuche, für neuere Präparate Vorteile zu propagieren, ähnlich zu bewerten (1-3). Dies gilt allerdings für Oxybutynin nur bedingt. So war in einem Review (2) für Oxybutynin die höchste Abbruchrate wegen Nebenwirkungen zu sehen, dies dürfte aber durch die nicht-retardierte Form verursacht sein, da in einem 2. Review (3, aber auch 6) die Retardform bezüglich Nebenwirkungen mit anderen Substanzen vergleichbar war, während die nicht-retardierte Form (vor allem in höheren Dosen) auch hier mehr Nebenwirkungen zeigte. Eine Erklärung könnte sein, dass gerade für die Mundtrockenheit eine rasche Anflutung und Blutspiegelspitzen PatientInnen für diese Nebenwirkung besonders anfällig machen. Dafür spricht auch, dass das transdermale Oxybutyninpflaster (Kentera) zu geringeren Graden von Mundtrockenheit (4,1% versus 7,3% mit Tolterodin) führt, allerdings bewirkt dieses Präparat bei 26% der PatientInnen lokale Pflaster-Reaktionen (siehe Pharmainfo XXI/4/2006), sodass der relativ geringen Reduktion der Mundtrockenheit diese häufige und auch belastende Nebenwirkung gegenübersteht.
Ein möglicher negativer Einfluss anticholinerger Substanzen auf kognitive Funktionen insbesondere bei älteren Personen ist in den letzten Jahren ausführlich diskutiert worden. Für die Gesamtheit von anticholinergen Substanzen aus mehreren Indikationen (z.B. trizyklische Antidepressiva, Antihistaminika, Blasentherapeutika) gibt es umfassende Daten. Ein rezenter Übersichtsartikel (7) über 46 Studien (randomisiert und epidemiologisch) fand für einen Großteil (77%) der Studien ein mit steigender Belastung durch Anticholinergika über Wochen bis 12 Jahre signifikantes Absinken der kognitiven Fähigkeiten (meist gemessen mit MMSE: Mini Mental State Examination). Für das Auftreten von Alzheimer-Demenz sind die Daten weniger klar, eine rezente Kohortenstudie (8) mit 3.434 Personen registrierte aber mit steigender Belastung durch Anticholinergika einen deutlichen Anstieg des Risikos (RR: 1,54; 1,21 – 1,96).
Ein negativer Einfluss generell von Anticholinergika scheint gut belegt, viel schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob dies für alle anticholinergen Blasentherapeutika gilt.
Trospium als einziges Präparat ist ein quarternäres Amin und daher sehr hydrophil. Für solche Substanzen ist die Bluthirnschranke eine effiziente Barriere. Tatsächlich erwies sich Trospium nach Gabe über 10 Tage (9) als nicht nachweisbar in der Cerebrospinalflüssigkeit. Dies wurde bei älteren PatientInnen (65 – 74 Jahre, n=12) getestet und spricht dafür, dass auch eine mögliche Reduktion der Bluthirnschranke, wie sie für das Alter postuliert wird (10a), sich offensichtlich nicht negativ auswirkt. Eine Änderung von kognitiven Funktionen (Gedächtnistests) war in dieser Studie nicht festzustellen. Auch eine weitere Beobachtungsstudie (10, n=35) zeigte für kognitive Funktionen unter Trospium zwar einige Fluktuationen, aber nach 4 Wochen war keine Änderung feststellbar.
Solifenacin und insbesondere Darifenacin haben eine gewisse Spezifität für M3-Rezeptoren (11), die für die Regulierung kognitiver Funktionen im Gehirn weniger relevant sein sollen.
Eine Beobachtungsstudie für Solifenacin (12, n=799) über 12 Wochen fand keine Veränderung kognitiver Funktionen (MMSE-Test). Auch bei PatientInnen (n=66) nach einem Schlaganfall blieben nach Gabe dieser Substanz über 2 Monate kognitive Funktionen unverändert (13). Eine Doppelblindstudie (14) über 21 Tage allerdings mit nur 26 PatientInnen (7 für Solifenacin, 11 für Oxybutynin, 8 Placebo) registrierte für Solifenacin bei mehreren Tests keinen Unterschied zu Placebo, aber auch für Oxybutynin nur in einer Sekundäranalyse (bei 2 von 5 Tests eine Verschlechterung, 2 Zeitpunkte kombiniert).
Für Darifenacin liegen 2 Doppelblindstudien vor (15,16). Die eine (15: n=129) dauerte 2 Wochen und fand keine Veränderung in „memory tests“. In der zweiten (16: n=150) über 3 Wochen wurde ebenfalls keine Veränderung beobachtet, für Oxybutynin allerdings war das der Fall.
Fesoterodin: Diese Substanz zeigt aufgrund ihrer schwachen Lipophilie im Vergleich zu den anderen Anticholinergika (außer Trospium) in Tiermodellen eine geringere Penetration in das ZNS (17). Zwei Doppelblindstudien über jeweils 12 Wochen (18: n=794; 19: n=563) beobachteten keine Veränderung in „memory tests“ (MMSE score).
Oxybutynin: Die oben zitierten Vergleichsstudien (14,16) zeigten für diese besonders lipophile Substanz PRO(Patient Reported Outcome)-negative Effekte.
Tolterodin und Propiverin: Es liegen anscheinend keine randomisierten Studien vor, die eine verlässliche Bewertung kognitiver Funktionen für diese Substanzen erlauben.
Eine rezente Studie (20) über 6 Monate registrierte mit dem MMSE-Test für Oxybutynin, Trospium und Tolterodin keine Veränderung, für Darifenacin eine zwar signifikante, aber nur 0,4 Punkte betragende (von 24,9 auf 24,5) Verschlechterung. Da dies eine Beobachtungsstudie war und den oben zitierten Daten für Darifenacin und Oxybutynin widerspricht, ist diese Studie nicht aussagekräftig.
Insgesamt muss man feststellen, dass für die Bewertung kognitiver Funktionen diese klinischen Studien nicht ausreichend und in den meisten Fällen zu kurz sind. Wir haben daher eine Diskrepanz zwischen den Studien, die generell für Anticholinergika negative Befunde (allerdings vor allem Beobachtungsstudien) gefunden haben, während für die meisten Einzelsubstanzen keine relevanten Daten erhoben wurden. Im Folgenden sei daher versucht, die Daten der vorliegenden klinischen Studien mit zusätzlichen Argumenten (Penetration ins ZNS, M3-Rezeptoren-Spezifität) zu korrelieren, um eine gewisse Wertung vorzunehmen. Wenn eine Substanz die Bluthirnschranke aufgrund ihrer Struktur nicht überwinden kann, ist es ein lang belegtes pharmakologisches Prinzip, dass sie im ZNS keine Wirkung entfalten kann. Dies gilt am klarsten für Trospium (allerdings mit nicht sehr verlässlichen klinischen Studien) und in zweiter Linie für Fesoterodin (mit besseren klinischen Studien). Für Darifenacin spricht die hohe M3-Rezeptoren-Spezifität (und im Vergleich relativ gute klinische Studien). Für Solifenacin ist die Rezeptor-Spezifität geringer und auch die Studien sind nicht optimal. Für Tolterodin und Propiverin sind keine verlässlichen Aussagen möglich und für Oxybutynin ist die Datenlage eher negativ.
Mirabegron (Betmiga)
Mirabegron erhielt eine europäische Zulassung (siehe EPAR, EMA, London). Die Indikation ist „symptomatische Therapie von imperativem Harndrang, erhöhter Miktionsfrequenz und/oder Dranginkontinenz bei Überaktivität (OAB, overactive bladder)“.
Mit dieser Substanz steht ein neues Wirkprinzip zur Verfügung. Über Stimulation von sympathischen ß3-Rezeptoren kommt es zur Erschlaffung des Blasen-Detrusormuskels und damit zu einer Erhöhung des Füllungsvolumens und der Speicherkapazität. Da die Zulassung keine kontroversiellen Probleme ergab (siehe EPAR), seien nur die wesentlichen Punkte zur Risiko/Nutzenabwägung diskutiert (siehe auch 21).
Wirkung: In den 3 Zulassungsstudien (n = 1306 – 1987; 25, 50 und 100 mg) ergaben sich nach 12 Wochen folgende Werte für die 24 Stunden-Inkontinenzfrequenz. Mit Placebo sank diese von 2,67 auf 1,54, also um 1,13, mit Verum von 2,83 auf 1,22, also um 1,61. Verum reduzierte also gegenüber Placebo diese Frequenz um 0,48/Tag (für 2 Tage eine Inkontinenz weniger). Für die Miktionsfrequenz waren die Werte für Placebo 11,71 versus 10,35 (Differenz 1,36), für Verum 11,65 zu 9,70 (Differenz 0,57). Die Unterschiede zu Placebo waren zwar statistisch signifikant, aber offensichtlich kann man nicht von einer deutlichen Wirkung sprechen (lt. EPAR „modest“).
Dies gilt auch für Responderanalysen. Eine Reduktion der Inkontinenzereignisse pro Tag um mehr als 50% war bei 37,8% in der Placebogruppe und bei 44,6% mit Mirabegron zu finden.
Wie wir in der Pharmainfo XXX/1/2015 diskutiert haben, wird heute auch der Bewertung durch die PatientInnen mehr Bedeutung zugemessen. Als PRO (Patient Reported Outcome) wurde u.a. eine Quality of Life Scala (OAB-q) ausgewertet, diese ergab aber keine „clinically meaningful“ Besserung durch Mirabegron (siehe EPAR) und dies gilt auch für weitere PRO-Parameter. Eine firmengesponserte Studie betont hingegen statistisch signifikante Unterschiede (22).
Für die Bewertung der Wirkung von Mirabegron ist ein Vergleich mit den Anticholinergika essentiell. Da direkte Vergleichsstudien fehlen, können nur Daten von separaten Studien verglichen werden. Für die 24 Stunden-Inkontinenzereignisse ist die Senkung gegenüber Placebo, wie oben ausgeführt, 0,48. Bei Anticholinergika, wie dies der EPAR (EMA, London) berechnet, liegen die Werte zwischen 0,21 und 1,08; für die Miktionsfrequenzsenkung mit Mirabegron 0,57, bei Anticholinergika 0,54 bis 1,3. Für Mirabegron ist also die klinische Wirkung „modest“, aber noch vergleichbar mit der ebenfalls nicht beeindruckenden Wirkung der Anticholinergika.
Nebenwirkungen: Mirabegron erscheint gut verträglich. In der Fachinformation werden als häufigste Nebenwirkungen Harnwegsinfektionen und Tachykardien angeführt. Bezüglich einer Erhöhung des Blutdrucks ist in den Zulassungsdokumenten (EPAR, EMA) nur ein Hinweis auf eine Steigerung im Durchschnitt von nur 1 mmHg zu finden, das sich aber nicht „translated into clinical adverse events“. In der Fachinformation wurde aber trotzdem vor einer Verwendung bei hohem Blutdruck (> 180 mmHg) gewarnt. Nach der Markteinführung traten nun schwerwiegende Fälle von Hypertonie bis zu hypertensiven Krisen mit kardiovaskulären und zerebrovaskulären Ereignissen auf. Dies führt jetzt zu einer Kontraindikation für Mirabegron bei schwerer Hypertonie. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass bei der Zulassung auch bei einem geringen Signal (1 mm Hg) vorsichtige Formulierungen zweckmäßig sind und dass, wie schon so oft, erst nach der Markteinführung schwerwiegende Nebenwirkungen erkannt werden können.
Nach Markteinführung sind bis jetzt auch 2 Fälle von leukocytoklastischer Vaskulitis beschrieben (23).
Kombination: Anticholinergika und Mirabegron haben verschiedene Wirkmechanismen. Eine Kombination zur Verstärkung der Wirkung bietet sich daher an. Eine erste doppelblinde Phase II-Dosisfindungsstudie (24, n=306) untersuchte Solifenacin und Mirabegron. Für die Miktionsfrequenz über 24 Stunden kam es durch die Kombination zu einer Verstärkung der Wirkung, betreffend die für PatientInnen besonders relevante Inkontinenzfrequenz waren keine Vorteile zu sehen. Offensichtlich sind Phase 3-Studien für diese wichtige Frage, ob eine Kombination die relativ moderate Wirkung der Einzelsubstanzen relevant verstärkt, notwendig.
Kosteneffizienz: Es liegen nur zwei Studien mit Firmenautoren (25,26) vor, die für Mirabegron, man möchte fast sagen wie zu erwarten, eine mit Tolterodin vergleichbare Kosteneffizienz finden (siehe auch 1). Bei Studien zur Ökonomie, bei denen die Auswahl und Bewertung von Parametern sehr subjektiv sein kann, sind firmenunabhängige Studien essentiell.
Welche Substanz verschreiben?
Da die relativ schwach ausgeprägte Wirkung auf die Blasensymptomatik sowohl für Anticholinergika als auch Mirabegron ähnlich ist, kann sie nicht als Auswahlkriterium verwendet werden. Auch für die anticholinergen Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit gilt, dass sich die anticholinergen Substanzen weitgehend gleichen. Allerdings dürften diese zumindest bei höheren Dosen des nicht-retardierten Oxybutynin (retardierte Formen in Österreich nicht registriert) eine höhere Frequenz haben. Das transdermale Oxybutynin (Kentera) zeigt geringere Mundtrockenheit, ist allerdings durch eine hohe Rate von lokalen Hautirritationen belastet. Die Frage, inwieweit Anticholinergika die kognitiven Funktionen beeinträchtigen oder gar eine Demenz begünstigen, ist nicht geklärt. Generell scheint für diese Substanzen ein Risiko zu bestehen. Für Blasenanticholinergika dürfte dies mit Trospium und Fesoterodin und in weiterer Folge mit Darifenacin und auch mit Solifenacin geringer sein. Auch wenn die Datenlage keineswegs eindeutig ist, spricht eine vorsichtige Vorgangsweise (primum non nocere) für die Bevorzugung dieser Präparatfolge.
Mirabegron hat bezüglich häufigen Nebenwirkungen gegenüber Anticholinergika einen Vorteil (cave allerdings schwere Blutdruckkrisen). Wenn die preisgünstigen Anticholinergika bei einem/r Patienten/in schlecht verträglich sind, kann dies ein Argument sein, das teurere Mirabegron zu verwenden.
Literatur
(1) Guidelines on Urinary Incontinence: Eur Ass Urol,2014
(2) Ann Int Med 156,861,2012
(3) Eur Urol 62,1040,2012
(4) Eur Urol 54,543,2008
(5) BJU Int 110,1767,2012
(6) Eur Urol 54,740,2008
(7) Age Ageing 43,604,2014
(8) JAMA Int Med 173,401,2015
(9) Int J Clin Pract 64,1294,2010
(10) Clin Drug Inv 32,697,2012
(10a) Med Sci Monit 6,314,2000
(11) Dement Ger Cogn Disord Extra 3,143,2013
(12) World J Urol 32,1041,2014
(13) Biol Pharm Bull 30,54,2007
(14) Eur Urol 64,74,2013
(15) J Urol 173,493,2005
(16) Eur Urol 50,317,2006
(17) J Urol 181,Suppl.227,2009
(18) J Am Ger Soc 61,185,2013
(19) J Urol 191,395,2014
(20) Ageing Ment Health 19,217,2014
(21) Neurourol Urodyn 33,17,2014
(22) Qual Life Res 24,1719,2015
(23) Med Letter 55,13,2013
(24) Eur Urol 67,577,2015
(25) Clin Drug Inv 35,83,2015
(26) J Med Econ 18,390,2015
SSRI und Schwangerschaft
Im Jahre 2005 hat die FDA gewarnt (siehe 1), dass der SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) Paroxetin (Generika, Seroxat) bei Gabe im ersten Drittel der Schwangerschaft zu kardialen Fehlbildungen führen kann. In den folgenden Jahren befassten sich zahlreiche Studien mit dieser Frage und es entstand eine widersprüchliche Datenlage (z.B. 2,3). Eine verlässliche Aussage in dieser Frage erscheint aber wichtig, da in Europa immerhin 1,1 – 4,5% der Frauen in der Schwangerschaft SSRI einnehmen (4; in den USA: 5,6 – 10,2%), während vor der Schwangerschaft dieser Prozentsatz bei 3,3 – 9,6% liegt (4).
In den Jahren 2014/2015 wurden nun mehrere sehr große Studien veröffentlicht, die eine verlässliche Aussage über die Risiken von SSRI in der Schwangerschaft ermöglichen sollten. Wir konzentrieren uns in der Diskussion auf SSRI und zwar Citalopram (Generika, Seropram), Escitalopram (Generika, Cipralex), Fluoxetin (Generika, Fluctine), Paroxetin und Sertralin (Generika, Gladem, Tresleen), da für andere Antidepressiva und weitere SSRI nicht vergleichbar ausführliche Daten vorliegen.
Offensichtlich sind prospektive randomisierte Studien zu dieser Frage nicht möglich, wir sind daher auf epidemiologische Studien angewiesen, die durch „confounding factors“ (Störfaktoren) verfälscht werden können. Ein einfaches Beispiel: Wenn schwangere Frauen einen erhöhten Alkoholkonsum verbunden mit depressiven Zuständen und daher eine antidepressive Therapie haben, könnten die durch Alkohol ausgelösten Fehlbildungen dieser Therapie zugeschrieben werden. Die Verlässlichkeit epidemiologischer Studien steht und fällt daher mit der größtmöglichen Korrektur für solche Faktoren. Die größte Studie (5) basiert auf Daten aus dem Norden Europas und erfasste 2,3 Mio Geburten, von denen 36.772 Mütter SSRI verwendeten. Bei diesen waren 1.357 kongenitale Fehlbildungen aufgetreten. Die Studie versuchte für möglichst viele „confounding factors“ wie Alter, Diabetes, Rauchen und andere Medikamente wie Antiepileptika zu korrigieren und wertete zusätzlich noch Daten von Müttern aus, die zumindest 2 Kinder hatten und die für SSRI-Einnahme und Fehlbildungen diskordant waren (sibling controls: 895 Familien).
Die unkorrigierte relative Risikorate (Odds ratio: OR) für alle SSRI war 1,18 (1,12 – 1,24), d.h. 3,7% aller Geburten betrafen Kinder mit Fehlbildungen nach SSRI-Exposition versus 3,4% der Kontrollen, nach Korrektur auf „confounding factors“ sank die OR auf 1,13 (1,06 – 1,20) und in den „sibling controls“ war sie 1,06 (0,9 – 1,24). Wenn man die Daten für die einzelnen SSRI betrachtet, dann findet man bei kardialen Fehlbildungen höhere Werte (1,34 bzw. 1,30) für Fluoxetin und Paroxetin, vor allem für Septumdefekte. Für das in dieser Studie auch untersuchte Venlafaxin (Generika, Efectin) waren diese Werte, so wie für die anderen SSRI (Citalopram, Escitalopram und Sertralin), nahe 1,0.
Eine weitere große Studie zu kardialen Fehlbildungen kam aus den USA (4) mit fast 1 Mio Geburten, davon 63.000 mit Antidepressiva-Exposition. Bei diesen kam es zu 580 kongenitalen Fehlbildungen. Für SSRI wurde eine unkorrigierte OR von 1,25 (1,13 - 1,38) gefunden, eine von 1,12 (1,00 – 1,26) wenn als Kontrolle Schwangere mit Depressionen aber ohne Antidepressiva-Medikation genommen wurden und eine von 1,06 (0,93 – 1,22) „when fully adjusted“. Für Paroxetin und Fluoxetin wurden keine höheren Werte errechnet und dies traf auch auf das trizyklische Antidepressivum Bupropion (Wellbutrin XR) zu.
Eine Studie aus England (6) mit 204 Fällen von kongenitalen Fehlbildungen nach SSRI-Exposition fand keine Erhöhung der Fehlbildungsrate. Für Paroxetin alleine wurde allerdings betreffend kardiale Fehlbildungen ein relativ höherer Wert von 1,78 (1,09 – 2,88) und zwar vor allem Septumdefekte erhalten.
Aufgrund dieser 3 großen Studien könnte man schließen, dass SSRI als Klasse betrachtet oder genauer gesagt zumindest Citalopram, Escitalopram und Sertralin kein oder höchstens ein sehr geringes Risiko für Fehlbildungen bedingen. Eine weitere Studie und zwar die rezenteste in diesem Jahr (7) mit einer Analyse von 2,1 Mio Geburten aus 12 europäischen Ländern mit 328 Fehlbildungen nach SSRI-Exposition scheint eine solche Schlussfolgerung wieder in Frage zu stellen.
In dieser Studie erfolgte keine Korrektur für confounding factors, Frauen mit Diabetes und antiepileptischer Therapie wurden allerdings ausgeschlossen. Eine sibling control war mit nur 3 erfassten Familien nicht zu bewerten. Für kardiale Fehlbildungen wurde eine OR von 1,41 (1,0 – 2,86) gefunden, wobei die Ratios bei Fluoxetin, Paroxetin und Citalopram ähnlich waren, bei Escitalopram (7 Fälle) mit 1,10 (0,4 – 2,95) allerdings niedriger. Da Citalopram auch das S-Enantiomer Escitalopram enthält, sollten diese beiden Substanzen analoge Risiken haben. Resultate mit geringen Fallzahlen (7 Fälle) sind offensichtlich nicht sehr verlässlich. Dies gilt auch für einzelne Fehlbildungen wie Ebstein-Anomalie, für die eine OR von 8,23 (2,92 – 23,16) gefunden wurde, allerdings basierend auf einer Fallzahl von 4. Auch für einzelne nicht-kardiale Fehlbildungen wie Anorektale Atresie, Gastroschisis, renale Dysplasie und Klumpfuß wurden signifikante OR gefunden (mit Fallzahlen von 6 bis 30). Aufgrund dieser Daten kamen die AutorInnen zum Schluss: „The data support a teratogenic effect of SSRI, but cannot exclude confounding“.
Dazu bieten aber die anderen drei Studien einen klaren Hinweis. In diesen Studien waren die unkorrigierten OR zwischen 1,01 und 1,25, also ebenfalls erhöht. Wenn aber confounding factors berücksichtigt werden, wenn Vergleiche mit depressiven Schwangeren ohne Medikation oder sibling controls (hier sollten confounding factors weitgehend wegfallen) durchgeführt werden, dann nähern sich diese Werte einer OR von 1,0. Dies spricht sehr überzeugend gegen einen Klasseneffekt von SSRI auf Fehlbildungen.
Allerdings finden sich in 2 (5,6) dieser 3 Studien für Paroxetin und Fluoxetin erhöhte Risiken (siehe auch 9) und dies stimmt mit der europäischen Studie (8) mit einer hohen Fallzahl (62 der gesamt 108 Fälle) für diese 2 SSRI überein.
Bezüglich Totgeburten und perinataler Mortalität sprechen die vorliegenden Daten (siehe 9) gegen einen Einfluss von SSRI, bezüglich postnatalem Neurodevelopment der Kinder nach SSRI-Exposition in der Schwangerschaft ist trotz vieler Studien ein negativer Effekt nicht belegt (siehe 10,11).
Zusammengefasst
Rezente große epidemiologische Studien, in denen auf Störfaktoren sorgfältig kontrolliert wurde, machen einen Klasseneffekt von SSRI auf kongenitale Fehlbildungen unwahrscheinlich. Wenn man die Daten für die einzelnen SSRI betrachtet, dann gilt dies für Citalopram, Escitalopram und Sertralin, für Paroxetin und Fluoxetin ist hingegen ein allerdings geringes Risiko möglich.
Eine schwere Depression in der Schwangerschaft hat für die Mutter und das Kind negative Folgen (siehe 11). Bei strenger Indikation hat daher die Therapie mit den gut untersuchten SSRI, Citalopram, Escitalopram und Sertralin eine positive Risiko/Nutzenbewertung.
Literatur
(1) NEJM 370,2397,2014
(2) Postgrad Med 122,49,2010
(3) Exp Opin 14,413,2015
(4) BJ Obstet Gyn 122,1010,2015
(5) BMJ 330,h1798,2015
(6) BJ Obstet Gyn 121,1471,2014
(7) Eur J Epid online: Wemacor
(8) BMJ 350,h3190,2015
(9) Dan Med J 61,84916,2014
(10) Eur Child Adolesc Psych 23,973,2014
(11) J Nerv Ment Dis 203,159,2015
Diclofenac (Generika) versus Naproxen (Generika)
Als Folge der Diskussion über kardiovaskuläre Risiken der Coxibe (Cox-II Hemmer) wurde dieses Risiko für alle NSAR (Nicht-Steroidale Antirheumatika) untersucht (siehe Pharmainfo XXIII/3/2008; XXVIII/3/2013).
Für Diclofenac wurde eine klare Risikoerhöhung (RR: 1,37; Cl 1,14 – 1,66) gefunden, wobei dies 3 zusätzliche schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse (davon ein Todesfall) pro 1.000 PatientInnen pro Jahr impliziert, bei PatientInnen mit CV-Risiko doppelt so viele (Pharmainfo XXVIII/3/2013). Hierauf hat die europäische Behörde für Diclofenac für die Fachinformation die gleiche Kontraindikation und Warnhinweise wie für Coxibe verfügt. Für Naproxen erschien ein kardiovaskuläres Risiko nicht gegeben und dies gilt auch zumindest für niedrige Ibuprofen-Dosen (Generika).
Zwei rezente Arbeiten haben dieses Thema erneut behandelt: eine dänische Kohortenstudie (1) analysierte die Daten von 17.320 PatientInnen mit rheumatoider Arthritis. Das kardiovaskuläre Risiko von NSAR war bei diesen Rheumatismus-PatientInnen niedriger als bei Kontrollen ohne diese Krankheit (1,22 versus 1,51). Für die einzelnen NSAR war bei diesen PatientInnen nur für Diclofenac (1,35; 1,11–1,64) und für das vom Markt genommene Rofecoxib (1,57; 1,16–2,12) ein signifikantes Risiko gegeben, keines hingegen für Ibuprofen (1,16; 0,96–1,41) und Naproxen (0,98; 0,47–2,06). In einer weiteren Arbeit (2) wurde über eine Network-Analyse von 154 Studien (26 davon betreffend kardiovaskuläre Nebenwirkungen) bei PatientInnen mit Osteoarthrose und rheumatoider Arthritis berichtet. Die AutorInnen kamen zu dem Schluss, dass Diclofenac sich bezüglich kardiovaskulärer Nebenwirkungen nicht von Celecoxib, Etoricoxib, aber auch Ibuprofen und Naproxen unterschied. Warum kommt diese Arbeit zu einem Ergebnis, das den obigen Daten und den früheren Resultaten (siehe Pharmainfo XXVIII/3/2013) klar widerspricht? Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass diese Studie von der Diclofenac-Firma finanziert wurde, auch zwei der AutorInnen sind Firmenangestellte. Es wäre wünschenswert, wenn Übersichtsartikel und Metaanalysen von Medikamenten, bei denen subjektive Kriterien, z.B. bei der Auswahl der Studien, eine Rolle spielen können, unabhängigen Institutionen überlassen würden.
Zusammengefasst: Nach wie vor gilt für NSAR heute eine überlegte Indikationsstellung mit dem Ziel, möglichst niedrige Dosen und kurzzeitig zu verwenden.
Für Coxibe und Diclofenac sind die Kontraindikationen (Herzinsuffizienz, ischämische Herzerkrankungen, periphere und zentrale Durchblutungsstörungen) und Warnhinweise (Vorsicht bei PatientInnen mit Hypertension, Hyperlipidämie, Diabetes und Rauchen) zu beachten – und dies betrifft einen beträchtlichen Teil älterer PatientInnen. Diese Überlegungen sollten durch Anzeigekampagnen für Diclofenac nicht einseitig beeinflusst werden.
Für PatientInnen mit kardiovaskulärem Risiko dürften Ibuprofen (allerdings nur in niedrigen Dosen: siehe EMA: 22/05/2015) und Naproxen (18/10/2012: EMEA/H/A-5(3)/1319) eine besser verträgliche Therapie darstellen (Pharmainfo XXVIII/3/2013).
In Deutschland sind von 2012 auf 2013 die Verschreibungszahlen von Diclofenac um 9,6% gesunken, hingegen für Ibuprofen um 9,8 und für Naproxen um 34,6% gestiegen (2014: minus 10,2% versus plus 5,2 und 26,9%: Arzneiverordnungsreport 2014/2015, U. Schwabe u. D. Paffrat).
Literatur
(1) Ann Rheum Dis 73,1515,2014
(2) Arthr Res & Ther 17,66,2015
Medikamente zur Prävention von Vorhofflimmern
Für Dronedaron (Multaq) wurde in einer Zulassungsstudie gezeigt (1), dass diese Substanz im Vergleich zu Placebo zu einer Reduktion von Hospitalisierungen aufgrund wiederauftretenden Vorhofflimmerns führt.
Ein Vergleich mit anderen Antiarrhythmika wurde nur für Amiodaron (Generika, Sedacoron: siehe 2), aber nicht für weitere Substanzen durchgeführt. Eine rezente, allerdings nur retrospektive Kohortenstudie (3) mit 8.562 PatientInnen hat nun die Zeitintervalle vom ersten Vorhofflimmern und der Verschreibung von Antiarrhythmika bis zur Hospitalisierung wegen neuerlichen Vorhofflimmerns für die Substanzen Amiodaron, Dronedaron, die Class 1c drugs Flecainid (Aristocor) und Propafenon (Rytmonorma) und Sotalol (Generika, Sotacor) miteinander verglichen. Dronedaron schnitt am schlechtesten ab, mit den im Durchschnitt frühesten Hospitalisierungen (HR 2,63; 1,77 – 3,89 versus Amiodaron, 1,59 versus Class Ic-Medikamente und 1,72 versus Sotalol). Die geringere Wirkung von Dronedaron versus Amiodaron in der Prävention eines neuerlichen Vorhofflimmerns bestätigt die Daten einer früheren Studie (siehe 2), zusätzlich zeigt sich aber jetzt, dass Dronedaron auch schwächer als Sotalol und Class Ic-Medikamente wirkt.
Zusammengefasst: Auch diese Studie bestätigt die beste Wirkung für Amiodaron. Eine rezente Guideline des American College of Cardiology (4) empfiehlt aber aufgrund der komplexen Nebenwirkungen von Amiodaron zuerst andere Substanzen zu verwenden. Aufgrund der obigen Arbeit sind dies die nächst wirksamen Substanzen Flecainid, Propafenon und Sotalol. Dronedaron, das chemisch dem Amiodaron ähnelt (allerdings kein Jod enthält), zeigt zwar nicht die relativ häufigen (5,9%: siehe Pharmainfo XXV/2/2010) Nebenwirkungen auf die Schilddrüse, teilt aber die Lebertoxizität mit dieser Substanz und auch das Risiko der Pneumonitis (Pharmainfo XXVI/4/2011). Da Dronedaron in Studien bei PatientInnen mit Herzinsuffizienz und permanentem Vorhofflimmern zu einer erhöhten Mortalität führte, wurde die Indikation auf ein Mittel zweiter Wahl eingeschränkt. Dafür, bzw. für ein Mittel fernerer Wahl, spricht jetzt auch die geringere Wirkung gegenüber allen obigen Substanzen.
Literatur
(1) NEJM 360,668,2009
(2) J Cardiovasc Electrophys 21,597,2010
(3) Circ Card Qual Outcomes 8,292,2015
(4) J Am Coll Card 64,e1,2014
E-Zigaretten
Wir haben kürzlich (Pharmainfo XXX/1/2015) über die unklare Datenlage zum Nutzen und Schaden von E-Zigaretten berichtet. Die US Prevention Services Task Force hat nun Folgendes, in Übereinstimmung mit uns festgestellt (BMJ 350, h2488, 2015): „The current evidence is insufficient to recommend electronic cigarettes for tobacco cessation”. Zur Raucherentwöhnung sollen die bewährten Mittel (Nikotinersatzpräparate und Vareniclin (Champix): siehe Pharmainfo XXVIII/3/2013) empfohlen werden.
P.b.b. Erscheinungsort Verlagspostamt 1010 Wien
Montag, 7. März 2016
Pharmainformation
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.



