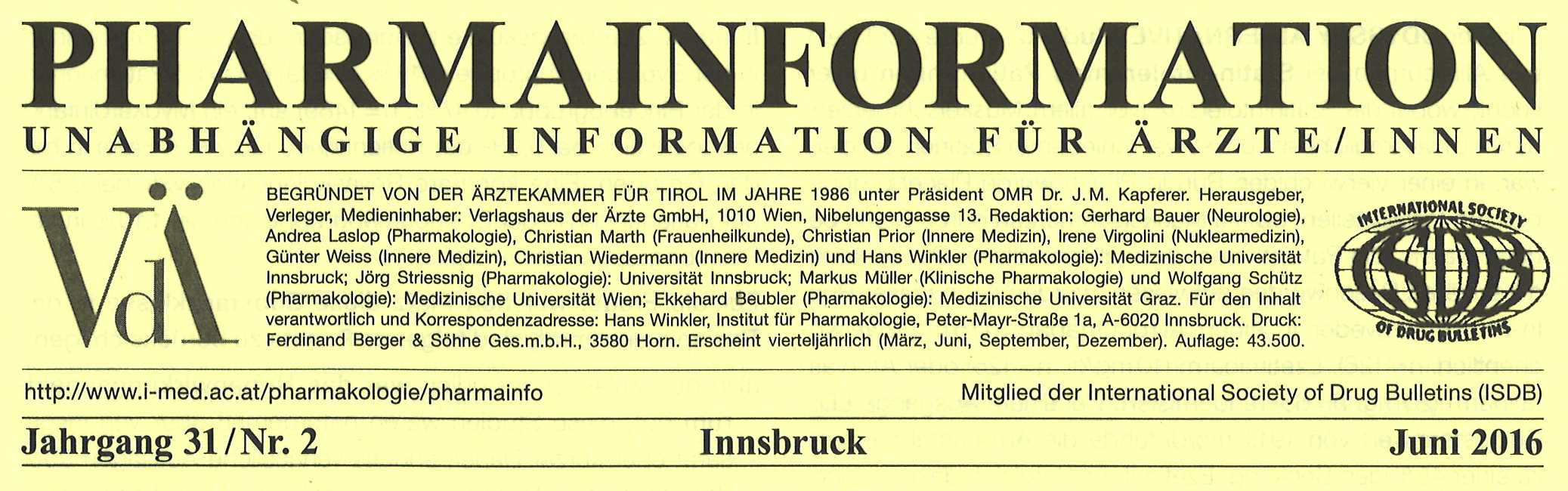
Inhalt
- Editorial
- PCSK9 Inhibitoren: Alirocumab (Praluent, Evolocumab (Repatha)
- Sacubitril/Valsartan (Entresto)
- Effektgrößen in klinischen Studien
- Update Obstipation: Naloxegol (Moventig)
- Menière: Betahistin
Editorial
Wir besprechen im Folgenden zwei neue und wichtige Substanzen bzw. –gruppen: PCSK9-Inhibitoren (Praluent und Repatha) und Sacubitril/Valsartan (Entresto).
Es ist interessant sie zu vergleichen: Beide beeinflussen endogene Proteasen und greifen dadurch in das pathophysiologische Geschehen ein, ein Wirkprinzip, das u.a. schon zu den erfolgreichen ACE (Angiotensin Converting Enzyme)-Hemmern und Hemmern der Dipeptidyl-Peptidase (Gliptine) geführt hat.
Bei der Risiko/Nutzenbewertung ist für beide Substanzen noch ungeklärt, ob sie möglicherweise zu einem erhöhten Alzheimerrisiko bzw. zu neurokognitiven Verschlechterungen führen können. Ein Risiko, das abgeklärt werden muss, auch wenn es derzeit für Alzheimer eher nur theoretisch vorliegt.
Betreffend den Nutzen ist für Entresto durch eine abgeschlossene Endpunktstudie bereits gezeigt, dass es im Vergleich zu Enalapril die Mortalität senkt und daher lebensverlängernd wirkt. Für die PCSK9-Inhibitoren liegen derzeit nur unvollständige Daten vor und erste Resultate der entscheidenden Endpunktstudie sind erst für 2017 zu erwarten.
Insgesamt bedeutet dies, dass für Entresto trotz des hohen Preises und nicht völlig abgeklärter Nebenwirkungen eine Indikation schon jetzt leichter zu sehen ist als für PCSK9-Hemmer, bei denen bei ebenfalls sehr hohen Preisen und nicht völlig geklärten Nebenwirkungen die Indikation besonders restriktiv sein muss, zumindest bis 2017, bis kardiovaskuläre Endpunktdaten vorliegen, die den Nutzen belegen.
PCSK9-Inhibitoren: Alirocumab (Praluent) und Evolocumab (Repatha)
Susanne Kaser, Innere Medizin 1, Medizinische Universität Innsbruck
Das proteolytische Enzym PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Typ 9) bindet an die LDL-Rezeptoren der Leberzellen und führt dazu, dass die durch Endozytose internalisierten LDL-Rezeptoren degradiert werden. Die beiden humanen monoklonalen Antikörper Alirocumab und Evolocumab verhindern eine extrazelluläre Bindung von PCSK9 mit dem LDL-Rezeptor, wodurch letztendlich die Verfügbarkeit von LDL-Rezeptoren an der Zelloberfläche erhöht wird und es zu einer vermehrten Aufnahme von LDL-Partikeln in die Leber kommt.
Alirocumab und Evolocumab erhielten eine europäische Zulassung zur Behandlung einer primären, d.h. genetischen Hypercholesterinämie (definiert als heterozygote familiäre Hypercholesterinämie oder nicht-familiäre Hypercholesterinämie) oder einer gemischten Hyperlipidämie bei PatientInnen, die zusätzlich zu dietätischen Maßnahmen bereits unter einer Statintherapie in maximal tolerierter Dosis und/oder einer anderen medikamentösen lipidsenkenden Therapie stehen und die LDL-Zielwerte nicht erreichen. Zudem sind die beiden PCSK9-Inhibitoren indiziert bei PatientInnen mit Statinunverträglichkeit oder Kontraindikation gegen eine Statintherapie als alleinige Therapie oder Kombinationstherapie mit anderen lipidsenkenden Medikamenten. Evolocumab ist zusätzlich zugelassen zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit einer homozygoten familiären Hypercholesterinämie ab einem Alter von 12 Jahren.
Beide Substanzen sind alle zwei Wochen subkutan zu verabreichen (Alirocumab 75 und 150 mg, Evolocumab 140 mg), Evolocumab kann auch einmal monatlich in einer Dosis von 420 mg s.c. verabreicht werden, wobei die LDL-Cholesterinkonzentrationen bei einer einmal monatlichen Gabe stärker schwanken.
Da die Cholesterin-senkende Wirkung der beiden Substanzen in mehreren Studien gut belegt ist, werden im Folgenden nur einige wesentliche Resultate diskutiert.
Effizienz der Substanzen:
Alirocumab: In der ODYSSEY Long Term Studie (1) wurden 2341 PatientInnen mit hohem kardiovaskulären Risiko untersucht, die unter maximal tolerierter Statindosis ein LDL-Cholesterin > 70 mg/dl hatten. Etwa 28% der untersuchten PatientInnen hatten zusätzlich zur Statintherapie noch eine weitere lipidsenkende Therapie, etwa die Hälfte davon Ezetimib (Ezetrol). 68% der PatientInnen wiesen eine koronare Herzerkrankung auf, 35% der untersuchten PatientInnen waren Typ-2-DiabetikerInnen. Die StudienteilnehmerInnen wurden in einem 2 : 1 Verhältnis zu einer 78-wöchigen Alirocumabtherapie (150 mg subkutan 2 mal wöchentlich) oder Placebo randomisiert. Bei einem Ausgangs-LDL-Wert von 122,8 mg/dl (Alirocumabgruppe) bzw. 122 mg/dl (Placebo) kam es nach 24-wöchiger Therapie zu einer mehr als 60%igen Reduktion auf einen durchschnittlichen LDL-Wert von 48,3 mg/dl in der Alirocumabgruppe, während die Placebogruppe erwartungsgemäß im Wesentlichen gleichbleibende LDL-Cholesterinwerte aufwies. Nach 78 Wochen betrug der durchschnittliche LDL-Wert in der Alirocumabgruppe 57,9 mg/dl.
In der ODYSSEY ALTERNATIVE Studie (2) wurde der Effekt von Alirocumab bei Statin-intoleranten PatientInnen untersucht, wobei die Statinintoleranz (vor allem Muskelschmerzen) durch Unverträglichkeit von ≥ 2 verschiedenen Statinen definiert war. In einer 4-wöchigen Run-in-Phase wurde Placebo gegeben um festzustellen, ob die Muskelschmerzen durch Statin bedingt waren. Die PatientInnen, die während dieser Phase keine muskulären Beschwerden aufwiesen, wurden nach dieser Run-in-Phase entweder in einen Alirocumabarm (75 mg 2-wöchentlich, n= 126), Ezetimibarm (10 mg/dl, n=125) oder Atorvastatinarm (20 mg, n=63) randomisiert. Bei einem Ausgangs-LDL-Cholesterinwert von 191,3 mg/dl führte die Alirocumabtherapie zu einer 45%igen Senkung, Ezetimib im Vergleich dazu zu einer 14,6%igen Senkung des LDL-Cholesterinwertes.
Evolocumab: In der DESCARTES Studie (3) wurden die Effizienz und Sicherheit einer 52-wöchigen Evolocumabtherapie bei 901 unterschiedlich vortherapierten PatientInnen mit Hyperlipidämie untersucht. PatientInnen wurden in einem 2 : 1 Verhältnis zu Evolocumab 420 mg s.c. vierwöchentlich oder Placebo randomisiert. Bei PatientInnen, die bei Studienbeginn unter alleiniger dietätischer Therapie standen, kam es zu einer signifikanten Reduktion des LDL-Wertes von 111,6 mg/dl auf 53,5 mg/dl, bei PatientInnen, die zusätzlich zu dietätischen Maßnahmen auch noch unter einer Atorvastatintherapie standen, zu einer Reduktion von 101,3 mg/dl auf 44,7 mg/dl (10 mg Atorvastatin) bzw. von 94,6 mg/dl auf 49,6 mg/dl (Atorvastatin 80 mg), und bei PatientInnen, die zusätzlich zu dietätischen Maßnahmen und Atorvastatin 80 mg auch noch Ezetimib 10 mg erhielten, zu einer Reduktion von 116,8 mg/dl auf 75 mg/dl (3).
Evolocumab führte im Durchschnitt bei 82,3% aller PatientInnengruppen zu einem LDL-C-Wert unter 70 mg/dl (3).
Bei 49 PatientInnen mit familiär homozygoter Hypercholesterinämie führte eine 12-wöchige Evolocumabtherapie (420 mg s.c. vierwöchentlich) bei vorbestehender hochpotenter Statintherapie (Rosuvastatin: Crestor oder Atorvastatin: Generika, Sortis) und Ezetimibtherapie (92% der eingeschlossenen PatientInnen) zu einer etwa 30%igen Reduktion des LDL-Cholesterins bei einem Ausgangswert von 347,5 mg/dl (4).
Nebenwirkungen:
Beide Substanzen erscheinen insgesamt gut verträglich. In der über 78 Wochen andauernden ODYSSEY Long Term Study (1) zeigten sich als wesentlichste Nebenwirkungen für Alirocumab neben lokalen Reaktionen an der Einstichstelle eine erhöhte Rate an Myalgien (5,4 vs. 2,9% für Placebo) und neurokognitive Auffälligkeiten wie Amnesie, Verschlechterung der Gedächtnisfunktion oder Verwirrung (1,2 vs. 0,5%); auch für Evolocumab wurden neurokognitiven Veränderungen nach einjähriger Therapie als seltene Nebenwirkung (0,9 vs. 0,3%) beschrieben (5).
Kardiovaskuläre Endpunkte:
Eine post-hoc-Analyse der Langzeitstudie mit Alirocumab (78 Wochen) zeigte im Vergleich zu Placebo eine signifikante Reduktion von kardiovaskulären Ereignissen (kardiovaskulärer Tod, non-fataler Myokardinfarkt oder Apoplex und Hospitalisierung wegen instabiler Angina pectoris) auf 1,7 vs. 3,3% im Placeboarm (1). Wenn man alle kardiovaskulären Endpunkte miteinbezieht, inklusive einer „ischemia-driven“ koronaren Revaskularisation, war der Unterschied geringer (4,6 vs. 5,1%).
Ähnliche Resultate lieferte eine explorative Datenanalyse einer einjährigen Evolocumabtherapie (2,18 vs. 0,95%:5). Insgesamt waren aber auch in dieser Studie die Fallzahlen sehr gering (gesamt 60 kardiovaskuläre Ereignisse bei 4465 eingeschlossenen PatientInnen), was die Aussagekraft zweifellos limitiert. Zerebrovaskuläre Ereignisse traten bei 4 PatientInnen in der Evolocumabgruppe (0,14%, n=2976) und 7 PatientInnen in der Placebogruppe (0,47%, n=1489) auf, ein Myokardinfarkt ereignete sich bei 0,3% der PatientInnen (9 bzw. 5 Fälle) in beiden Gruppen. Eine koronare Revaskularisation war bei 0,5% der PatientInnen in der Evolocumabgruppe und bei 1,10% in der Placebogruppe notwendig (5).
Für die Frage, welchen Platz diese Substanzklasse in der Therapie einnimmt, sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
a) In den Zulassungsstudien war das Nebenwirkungsspektrum gut, diese Studien waren naturgemäß aber von insgesamt eher kurzer Dauer, sodass verlässliche Aussagen über das langfristige Nebenwirkungsprofil erst durch Langzeitstudien in der Postmarketing-Phase getroffen werden können.
b) Erste allerdings nur vorläufige Daten sprechen für eine günstige Beeinflussung der kardiovaskulären Endpunkte, es fehlen allerdings noch Daten aus prospektiven Langzeit-Studien, sodass die Frage nach einer kardiovaskulären Risikoreduktion im Vergleich zu Statinen oder zusätzlich zu einer Statintherapie derzeit nicht geklärt werden kann.
c) Die Kosten der Substanzklasse stellen aus gesundheitsökonomischer Sicht sicherlich eine Limitation dar, insbesondere da eine lipidsenkende Therapie in der Regel lebenslang erfolgen muss.
Indikationen:
a) Für PatientInnen mit homozygoter Hypercholesterinämie besteht eine klare Therapieindikation.
b) Einsatz bei nicht-ausreichender LDL-C-Senkung unter lipidsenkender Therapie:
Aktuelle Daten vom EURIKA-Programm zeigen, dass PatientInnen mit hohem kardiovaskulären Risiko (kardiovaskuläre 10-Jahresmortalität > 5%) oder sehr hohem kardiovaskulären Risiko (kardiovaskuläre 10-Jahresmortalität > 10%) nicht nur viel zu selten behandelt werden (65,3% bzw. 49,5%), sondern dass auch PatientInnen unter lipidsenkender Therapie selten die Zielwerte erreichen (hohes kardiovaskuläres Risiko: 61,3%, bzw. sehr hohes kardiovaskuläres Risiko: 82,9%: 6). Erst wenn trotz maximal tolerierter hochpotenter Statintherapie (Atorvastatin, Rosuvastatin) und Zugabe von Ezetimib die LDL-Zielwerte signifikant verfehlt werden, besteht eine Indikation für eine PCSK9-Hemmer-Therapie.
c) Einsatz bei Statin-Intoleranz: Laut Zulassung indiziert ist eine PCSK9-Hemmer-Therapie auch bei Statinintoleranz, wobei die Definition letzterer sicherlich sehr kritisch hinterfragt werden muss. Eine Statin-assoziierte Myopathie (bis hin zur Rhabdomyolyse) mit signifikanter Erhöhung der CK ist eine seltene, wenn auch gefährliche Nebenwirkung, die mit einer Häufigkeit von 1:1000 (Myopathie) bis 1:10000 (Rhabdomyolyse: 8) unter einer Standardstatindosis vorkommt. Statin-assoziierte Muskelsymptome (Myalgien) werden in verschiedenen Registern und Observationsstudien allerdings mit sehr stark variierenden Häufigkeiten von 3-5% (8) oder 7-29% (7) angegeben. Dem gegenüber zeigte sich in der bereits oben besprochenen ODYSSEY ALTERNATIVE Studie (2), dass von 361 PatientInnen, die vorab als Statin-intolerant klassifiziert wurden (definiert als Unverträglichkeit gegenüber 2 oder mehreren Statinen), 25 PatientInnen (6,9%) während der einmonatigen Placebo Run-in-Phase muskuläre Symptome entwickelten, also ihre Muskelschmerzen nicht durch Statine verursacht wurden. In weiterer Folge wurden 63 PatientInnen mit Atorvastatin 20 mg weiterbehandelt, von diesen mussten nur 14 PatientInnen (22,2%) wegen Muskelbeschwerden die Statintherapie vorzeitig absetzen, bei denjenigen PatientInnen, die Alirocumab erhielten, waren es allerdings auch noch 20 (von 126: 15,9%). Diese Daten bestätigen für PCSK9-Hemmer ein geringeres (15,9% vs. 22,2%), aber bei dieser PatientInnengruppe doch beträchtliches Risiko für Myalgien, zeigen aber auch, dass trotz angeblich vorliegender Statin-Intoleranz nur 14 von 63 PatientInnen bei Statin Reexposition schwere Muskelschmerzen zeigen.
Eine einheitliche Definition für das Vorliegen einer Statin-Intoleranz besteht nicht. In einem Positionspapier (8) wurde vorgeschlagen, die Statin-Intoleranz dahingehend zu definieren, dass zumindest 2 verschiedene Statine – eines davon in der niedrigsten Dosierung - nicht toleriert werden, die Intoleranz durch spezifische klinische Symptome oder relevante Laborpathologien bestätigt wird, die Symptome oder Biomarker sich bei Dosisreduktion oder Absetzen der Statintherapie zurückbilden oder verschwinden, und dass die Beschwerden nicht durch prädisponierende Faktoren oder Medikamentenwechselwirkungen (9) erklärbar sind. Erst wenn eine Statin-Intoleranz verläßlich diagnostiziert ist, ist eine lipidsenkende Therapie mit dieser teuren Substanzklasse, deren Risiko/Nutzen-Verhältnis durch kardiovaskuläre Langzeitstudien derzeit noch nicht sicher geklärt ist, in dieser Indikation vertretbar.
Literatur:
(1) N Engl J Med 372,1489,2015
(2) J Clin Lipidol 9,758,2015
(3) N Engl J Med 370,1809,2014
(4) Lancet 385,341,2015
(5) N Engl J Med 372,1500,2015
(6) PLosOne 10 e0115270,2015
(7) Eur Heart J 36,1012,2015
(8) Arch Med Sci 11,1,2015
(9) Am J Cardiol 113,1765,2014
Neu registriert: Sacubitril/Valsartan (Entresto)
Dieses Kombinationspräparat hat eine europäische Zulassung (siehe EPAR, EMA, London) für folgende Indikation erhalten: Zur Behandlung bei erwachsenen PatientInnen einer symptomatischen Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion.
Sacubitril hemmt das proteolytische Enzym Neprilysin, eine Endoprotease, die neben anderen Peptiden (z.B. Angiotensin, Endothelin, Amyloid ß-Peptid) auch natriuretische Peptide (z.B. BNP: Brain Natriuretic Peptide, gebildet in den kardialen Myozyten) abbaut. Durch den verminderten Abbau der natriuretischen Peptide wird deren Wirkung, wie Vasodilatation, Blutdrucksenkung, Hemmung des Sympathikus und Steigerung der Diurese verstärkt. Wenn nur Neprilysin gehemmt wird, erfolgt eine Hinaufregulation des Renin/Angiotensin-Systems und damit eine Neutralisierung dieser Effekte. Die Zugabe des Angiotensin-II-Blockers Valsartan verhindert dies und macht diese Kombination sinnreich (1).
Die entscheidende Zulassungsstudie war eine Doppelblindstudie an 8.442 PatientInnen in 1.043 Zentren in 47 Ländern (Paradigm–HF-Studie: 2) mit chronischer Herzinsuffizienz und einer linksventrikulären Auswurffraktion von höchstens 40% (im Lauf der Studie auf 35% geändert), die zumindest 4 Wochen stabil auf einen ACE-Hemmer oder AT-Blocker und Betablocker eingestellt waren und Symptome der NYHA-Klasse II bis IV (mehr als 90% waren in II und III) hatten. In einer „run-in“-Phase wurde an Stelle der bisherigen Medikation von ACE-Hemmern/AT-Blockern für 2 Wochen Enalapril und dann für 6 Wochen Sacubitril/Valsartan verabreicht. Nur diejenigen PatientInnen, die diese Medikation tolerierten, wurden in die Studie aufgenommen (11,4% schieden daher aus). In der folgenden Doppelblindstudie erhielten die PatientInnen Enalapril bzw. Sacubitril/Valsartan unter Beibehaltung der Basistherapie (Diuretika: 80%, Betablocker 93% und Aldosteron-Antagonisten 55%). Nach 27 Monaten wurde die Studie aufgrund der bereits vorliegenden positiven Ergebnisse abgebrochen.
Der Primärparameter in dieser Studie war zusammengesetzt aus Hospitalisierung wegen Herzinsuffizienz und kardiovaskulärer Mortalität. Er wurde durch das Kombinationspräparat von 26,5% auf 21,8% gesenkt (HR 0,8; Cl 0,73 – 0,87; p<0,001), wobei beide Einzelkomponenten nahezu gleich (20 bzw. 21%) absanken. Für die kardiovaskuläre Mortalität ergab sich eine Number Needed to Treat (NNT) von 32 (von 16,5 auf 13,3%) und für die Gesamtmortalität eine NNT von 36 (19,8 zu 17%).
Weitere Analysen der Paradigm-HF-Studie liegen vor (3-5). PatientInnen mit sinkender Auswurffraktion haben ein steigendes Mortalitätsrisiko. Sacubitril/Valsartan war über das gesamte Risiko-Spektrum ähnlich wirksam (3). Die PatientInnen der Studie waren zum Großteil in NYHA-Klasse II und III mit relativ milder Symptomatik, das individuelle Mortalitätsrisiko kann sich aber deutlich unterscheiden und z.B. mit dem MAGGIC-Score bewertet werden (4). Wenn die Daten der Studie mit dieser Methode analysiert wurden, ergab sich für den Primärparameter eine NNT für die Hochrisiko-PatientInnen von 15, für die mit dem niedrigsten Risiko von 33 (4).
Neben den bereits diskutierten Parametern wurden auch weitere wie Intensivierung der Medikation, Intensivstation-Aufenthalte, Notwendigkeit inotroper Medikamente und Herztransplantationen analysiert und durch das Kombinationspräparat als signifikant reduziert gefunden (5).
Basierend auf den Daten der Paradigm-HF-Studie kann für Sacubitril/Valsartan versus Enalapril eine durchschnittliche Lebensverlängerung von 11,6 Jahren auf 12,9 Jahre berechnet werden (6).
Bei den Nebenwirkungen war im Vergleich von Sacubitril/Valsartan (2) mit Enalapril Husten im Vergleich seltener (11,3 vs. 14,3%), ebenso Hyperkaliämie und erhöhtes Serum-Kreatinin.Häufiger waren symptomatische Hypotension (14,0 vs. 9,2%) und überraschenderweise Angioödem, da dies ja typisch für ACE-Hemmer wie Enalapril ist (0,5 vs. 0,2%), allerdings nur numerisch. Ob letzteres durch weitere Daten bestätigt wird, wird sich zeigen. Auf jeden Fall ist ein anamnestisch bekanntes Angioödem eine Kontraindikation für Entresto (siehe Fachinformation).
Neprilysin ist eines der wichtigsten Enzyme zum ß-Amyloid-Abbau (7,8). Der Akkumulation von Amyloid-Peptiden wird eine wichtige Rolle in der Alzheimer-Pathogenese zugesprochen. Kann daher die Hemmung von Neprilysin durch Sacubitril einen negativen Einfluss im Alzheimer-Geschehen haben? Eine theoretische Möglichkeit, gegen die derzeit nur einige, nicht im Detail publizierten Daten sprechen (siehe EPAR, EMA, London, Fachinformation, 8,9). In der Zerebrospinalflüssigkeit von Affen kam es unter Entresto-Gabe über 2 Wochen zu einer Akkumulation von Amyloidpeptiden, aber nicht im Gehirngewebe. In der Zerebrospinalflüssigkeit von gesunden Probanden kam es durch Sacubitril zu keinem Anstieg der Amyloidpeptide AB1-40 und AB1-42, allerdings schon von AB1-38, wobei die Relevanz von letzterem Peptid unklar ist. Auf jeden Fall hat die FDA eine Langzeitstudie an PatientInnen mit neurokognitivem Test und Imaging (PET)-Studien vorgeschrieben, die allerdings erst 2022 abgeschlossen wird (8). In der Zwischenzeit sollten detaillierte Daten über den Stoffwechsel und die Akkumulation von Amyloidpeptiden im Gehirn von Tieren und in der Zerebrospinalflüssigkeit von Menschen publiziert werden und in laufenden Langzeitstudien sollten kognitive Tests eingeschlossen werden.
Zusammenfassung:
Sacubitril/Valsartan senkt bei PatientInnen mit Herzinsuffizienz besser als der ACE-Hemmer Enalapril die kardiovaskuläre und Gesamtmortalität (NNT für 2 Jahre: 32 bzw. 36) und führt zu einer Lebensverlängerung von 11,6 auf 12,9 Jahre.
Die Substanz erscheint gut verträglich. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass in der Zulassungsstudie in einer „run-in“-Phase 11% der PatientInnen, die Verträglichkeitsprobleme zeigten, ausgeschieden wurden.
Relativ häufig sind symptomatische Hypotensionen, ob Angioödeme vermehrt auftreten, ist noch unklar. Ein Hinweis auf ein mögliches Alzheimer-Risiko ist derzeit nur theoretisch gegeben, aber nicht auszuschließen. Demgegenüber steht aber die gute Wirksamkeit mit Lebensverlängerung.
Literatur:
(1) Ann Pharmacother 49,1237,2015
(2) NEJM 371,993,2014
(3) Circ Heart Fail 9,e002744,2016
(4) J Am Coll Card 66,2059,2015
(5) Circulation 131,54,2015
(6) NEJM 373,2289,2015
(7) Eur Heart J 36,902,2015
(8) JAMA 315,25,2016
(9) NEJM 371,2336,2014
Interpretation von Effektgrößen in klinischen Studien
Martin Posch und Gerd Rosenkranz, Institut für Medizinische Statistik, Zentrum für Medizinische Statistik, Informatik und Intelligente Systeme, Medizinische Universität Wien
(Diese Arbeit wurde durch das UK MRC grant MR/M005755 unterstützt).
Die Entscheidung über Erfolg oder Misserfolg klinischer Therapiestudien basiert oft auf p-Werten statistischer Tests. Statistisch “hoch signifikante” Effekte werden dabei ohne weitere Prüfung fälschlicher Weise mitunter auch als klinisch bedeutende Effekte interpretiert. Die statistische Signifikanz (und damit der p-Wert eines statistischen Tests) hängt aber nicht nur von der Effektgröße ab, sondern ebenso von der Wahl des statistischen Tests, der Variabilität des Endpunkts und der Stichprobengröße. Daher kann man aus der statistischen Signifikanz nicht direkt auf die Größe und damit Relevanz des Effekts schließen.
Betrachten wir als Beispiel einen Parallelgruppenvergleich einer experimentellen Behandlung mit einer Kontrolle in einer zweiarmigen randomisierten Überlegenheitsstudie. Der statistische Signifikanztest untersucht dabei die Frage, ob beobachtete Gruppenunterschiede auf einen systematischen Unterschied zurückzuführen sind oder auch durch Zufallsschwankungen erklärt werden können. Der Test gibt aber keine direkte Information über die Größe eines etwaigen Unterschieds.
Wie kann man die Effektgröße bei Ereignisdaten beschreiben und interpretieren?
Die Wahl des Effektmaßes hängt insbesondere von der Art des betrachteten Endpunkts ab. Ist der Endpunkt zum Beispiel ein Ereignis, wie etwa die Spitalsmortalität, oder Response einer Tumortherapie, wird der Behandlungseffekt auf Basis der Responseraten in der Behandlungs- und der Kontrollgruppe berechnet. Daraus können mehrere Effektmaße abgeleitet werden: der absolute Effekt, definiert durch die Differenz der Responseraten (Risikodifferenz), oder der relative Effekt, definiert als der Quotient der Responseraten (Risikoverhältnis). Die absolute Risikodifferenz ist der, im Vergleich zur Kontrollgruppe, zusätzliche Prozentsatz an PatientInnen, die eine Response erfahren (berechnet als Prozentsatz von allen behandelten PatientInnen). Dieser kann gut direkt interpretiert, oder auch als “Number Needed to Treat” (NNT) ausgedrückt werden. Die NNT gibt dabei die mittlere Anzahl an PatientInnen an, die behandelt werden müssen, um eine zusätzliche Response im Vergleich zur Kontrolle zu erreichen.
Das Risikoverhältnis ist in Bezug auf die Relevanz des Effekts schwieriger zu interpretieren. Wenn etwa die Responserate in der Kontrollgruppe klein ist, so kann trotz eines großen Risikoverhältnisses die absolute Risikodifferenz sehr klein (und daher die NNT sehr groß) sein. Ist beispielsweise das Risiko einer Nebenwirkung unter Standardtherapie 0,001 und verdoppelt es sich unter der Testbehandlung auf 0,002, beträgt die Risikodifferenz lediglich 0,001 und es müssen etwa 1000 PatientInnen mit der neuen Therapie behandelt werden, um eine zusätzliche Nebenwirkung zu beobachten. Verdoppelt sich das Risiko von 0,1 auf 0,2, ist bereits bei etwa 10 PatientInnen unter der Testbehandlung eine zusätzliche Nebenwirkung zu erwarten. In beiden Fällen ist das relative Risiko jedoch gleich 2.
Wie hängt die Effektgröße mit p-Werten zusammen?
In vielen Fällen beobachtet man große Effekte in Zusammenhang mit kleinen p-Werten. Ein Beispiel zeigt jedoch, dass dies nicht zwingend so sein muss. Betrachtet werden die Resultate zweier Studien, die Bestandteil einer Meta-Analyse zur Untersuchung des Einflusses von Betablockern (BB) auf das Auftreten von Diabetes sind (1). Die AASK Studie (2) vergleicht den BB Metoprolol mit Amlodipin, die LIFE Studie (3) den BB Atenolol mit Losartan, jeweils in unterschiedlichen PatientInnen-Populationen. Obwohl der Schätzer für das relative Risiko in der AASK Studie größer (und die NNT kleiner) als in der LIFE Studie sind, ist der p-Wert der AASK Studie größer als in der LIFE Studie. Die Resultate sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. In den Therapiespalten sind jeweils die Anzahl der neu aufgetretenen Diabetesfälle und die Gesamtzahl der therapierten PatientInnen angegeben. Die p-Werte (auf Basis einer logistischen Regression) und die NNTs, die hier als Number needed to harm zu interpretieren sind, wurden aus den Resultaten der Publikationen nachträglich berechnet.
|
Studie |
Betablocker |
Vergleichstherapie |
Relatives Risiko |
p-Wert |
NNT |
|
AASK |
70/405 |
45/410 |
1,57 (1,11; 2,23) |
0,0102 |
16 |
|
LIFE |
319/3979 |
241/4019 |
1,34 (1,14; 1,57) |
0,0004 |
50 |
Wie kann man die Relevanz von Effekten bei metrischen Endpunkten interpretieren?
Für metrische Endpunkte, wie etwa den systolischen Blutdruck oder klinische Scores wie z.B. den Hamilton Depression Score, werden meist Gruppenmittelwerte verglichen. Die beobachtete absolute Effektgröße wird dann als die Differenz der Mittelwerte in der Behandlungs- und Kontrollgruppe berechnet.
Welche klinische Relevanz kommt nun einem geschätzten mittleren Behandlungseffekt zu?
Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass ein über Gruppen von PatientInnen gemittelter Outcome keine direkte Aussage für die Outcomes einzelner PatientInnen zulässt. Die Daten der einzelnen PatientInnen können stark schwanken, so dass sich die Verteilungen der Gruppen überlappen können. Selbst wenn insgesamt ein positiver Behandlungseffekt beobachtet wurde, kann es PatientInnen in der Behandlungsgruppe geben, deren Outcome schlechter als der mittlere Outcome der Kontrollgruppe ist. Wie stark sich die Verteilungen der Outcomes in den beiden Gruppen überlappen, hängt sowohl von der absoluten Größe des Effekts als auch der Variabilität der einzelnen Outcomes ab.
Ein Maß, das den mittleren Behandlungseffekt in Bezug zur Variabilität des Outcomes innerhalb der Behandlungsgruppen stellt, ist Cohens d, auch als Effektstärke oder - in der englischen Literatur - effect size bezeichnet, das den mittleren Gruppenunterschied in Einheiten der Standardabweichung innerhalb der Gruppen angibt. Der gleiche absolute Gruppenunterschied kann daher, je nach Variabilität, zu einem großen oder kleinen Cohens d führen. Andererseits können große Gruppenunterschiede bei großer Datenvariabilität das gleiche Cohens d ergeben wie kleine Gruppenunterschiede bei kleiner Variabilität.
Die Berechnung der Effektstärke soll an zwei Beispielen illustriert werden (4). In der RUPP Studie (5) wurden 128 PatientInnen mit Angststörungen mit Placebo und Fluvoxamin behandelt. Im zweiten Beispiel (6) wurden 96 depressive Kinder mit Fluoxetin und Placebo behandelt. In beiden Fällen wurde der Behandlungserfolg mit einem geeigneten Score gemessen. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Effektstärke erhält man aus der absoluten Mittelwertdifferenz der jeweiligen Studie dividiert durch die Wurzel der mittleren Varianz der beiden Gruppen. Im ersten Fall ergibt dies 6.9/[(7.02 + 5.32)/2]0.5 = 1.1. Vergleicht man die Resultate der beiden Studien, lässt die größere Mittelwertdifferenz nicht auf eine größere Effektstärke schließen.
|
Studie |
Testpräparat Mittelwert (SD) |
Placebo Mittelwert (SD) |
Mittelwertdifferenz (95% Konfidenzint.) |
Cohens d |
p-Wert |
|
RUPP |
9,0 (7,0) |
15,9 (5,3) |
-6,9 (-9,2; -4,6) |
1,1 |
<0,001 |
|
Emslie et al. |
38,4 (14,8) |
47,1 (17,0) |
-8,7 (-15,2; -2,2) |
0,55 |
0,002 |
Unter der Annahme normalverteilter Daten mit gleichen Varianzen in den beiden Gruppen kann aus Cohens d der Anteil der Beobachtungen in der Behandlungsgruppe, die größer als der Kontrollgruppenmittelwert sind, direkt abgeleitet werden: Für Cohens d=0 ist dieser Anteil 50%, für d=0,2 ist er 58%, für d=0,5 ist er 69%, für d=0,8 ist er 79%, für d = 1 ist er 84% und erst für d=1,6 steigt der Anteil auf 95%. Als Konvention werden daher Effektstärken von d=0,2 als klein, 0,5 als mittlere und Effektstärken ab 0,8 als große Effekte bezeichnet. Nach dieser Klassifizierung erzielt die RUPP Studie eine große Effektstärke mit mehr als 85% der FluvoxaminpatientInnen mit Scores unter dem Mittelwert der Placebogruppe. Die zweite Beispielstudie zeigt nur eine mittlere Effektstärke mit etwa 70% der FluoxetinpatientInnen unter dem Placebomittel.
Dieses Ergebnis überrascht auf den ersten Blick, jedoch sollte man bedenken, dass die Variabilität, von der Cohens d ebenfalls abhängt, durch das Studiendesign, die Einschlusskriterien und die Durchführung der Studie beeinflusst werden kann. Damit reflektiert die Effektstärke nicht ausschließlich den Behandlungseffekt, sondern auch andere Aspekte der Studie, so dass unterschiedliche Effektstärken nicht unbedingt auf unterschiedliche Behandlungseffekte zurückzuführen sind. Im konkreten Fall sollte daher die Effektstärke im jeweiligen Kontext gemeinsam mit dem absoluten Gruppenunterschied interpretiert werden.
Eine kontrovers diskutierte Methode, um die klinische Relevanz eines mittleren Behandlungseffekts zu beschreiben, ist die sogenannte Responderanalyse. Dabei wird ein Grenzwert für den metrischen Endpunkt festgelegt und PatientInnen, deren Resultat über dem Grenzwert liegt, als „Responder“ und alle anderen als “Non-Responder” definiert. So können Responseraten in Behandlungs- und Kontrollgruppe verglichen werden, wie zum Beispiel der Anteil der PatientInnen, deren Outcomescore sich um mehr als 50% verbessert. Oft wird dies für mehrere Grenzwerte (z.B. 30%, 50% und 70% Verbesserung) wiederholt. Basierend auf diesen Responseraten, können dann die Effektmaße für Ereignisdaten (siehe oben) berechnet werden.
Die Responderanalyse hat mehrere Nachteile. Ein generelles Problem ist die Relevanz des Grenzwerts, der oft ad hoc bestimmt wird. Ferner führt die Einteilung in Responder und Non-Responder zu einer Informationsreduktion, da z.B. nicht zwischen PatientInnen, die nur knapp über dem Grenzwert und solchen, die weit davon entfernt sind, unterschieden wird. Dieser Informationsverlust führt unter anderem dazu, dass die statistische Unsicherheit der Effektschätzung größer wird.
Welche Herausforderung stellen Überlebenszeiten dar?
Eine besondere Herausforderung ist die Messung der Effektgröße in der Überlebenszeitanalyse. Hier werden oft die Hazard Ratio, der Unterschied in der medianen Überlebenszeit, sowie die Überlebensrate zu bestimmten Zeitpunkten (z.B. 5-Jahresüberlebensrate) angegeben. Je nach der Form der entsprechenden Überlebenskurven können sich diese Effektgrößen stark voneinander unterscheiden. So wurde z.B. in einer Studie in akuter myeloischer Leukämie (7) zwar eine nahezu Verdreifachung des medianen Überlebens beobachtet (von 26 auf 75 Monate), die 5-Jahresüberlebensraten unterschieden sich aber nur um 8 Prozentpunkte (43 versus 51 Prozent). Für eine vollständige Beschreibung von Überlebenszeiten ist daher die Angabe mehrerer Effektmaße nötig.
Was ist noch bei der Entscheidung auf Relevanz eines Effektes zu beachten?
Bislang betrachteten wir ausschließlich sogenannte Punktschätzer für Behandlungseffekte.
Jedoch unterliegen die in einer Studie beobachteten Effektgrößen Zufallsschwankungen. Insbesondere bei kleinen Fallzahlen oder bei großer Variabilität des Outcomes kann die resultierende Unsicherheit der Schätzung substantiell sein und muss bei der Interpretation entsprechend berücksichtigt werden. Um die Präzision eines Schätzers zu beschreiben, werden sogenannte Vertrauensbereiche berechnet. Für ein Konfidenzniveau von 95% gilt etwa, dass im Mittel 95% der Vertrauensbereiche den wahren Behandlungseffekt überdecken. In der oben zitierten AASK Studie ist das geschätzte relative Risiko 1,57 mit einem 95% Konfidenzintervall von (1,11; 2,23). Das heißt, dass eine beträchtliche Unsicherheit bezüglich des Ausmaßes des Effekts besteht.
Besondere Vorsicht bei der Interpretation von Effektschätzern ist bei Subgruppenanalysen angebracht. Wird etwa der Behandlungseffekt einer Therapie in mehreren Subgruppen untersucht, aber nur jene Subgruppe, in der der größte Behandlungseffekt beobachtet wurde, berichtet, so führt das zu einer Verzerrung der Schätzung, dem sogenannten Selektionsbias. Für diesen kann man die Schätzer mit Hilfe spezieller Methoden für multiple Vergleiche korrigieren (8).
Neuere statistische Ansätze berücksichtigen bereits bei der Studienplanung ein Relevanzkriterium. Dies erlaubt es, die Entwicklung eines Medikaments nur dann fortzuführen, wenn Studien in der frühen Phase der Entwicklung - sogenannte Proof-of-Concept Studien - neben der Signifikanz noch ein Relevanzkriterium erfüllen (9).
Die Entscheidung, ob ein positives Resultat einer Studie auch relevant ist, kann nicht auf der Basis einer einzigen Zahl, etwa eines p-Wertes getroffen werden oder durch die Feststellung eines signifikanten Unterschieds. Zur Beurteilung sind die Werte eines oder mehrerer geeigneter Maße für die Effektgröße und ihrer Variabilität erforderlich. Die Eignung hängt von der Art der erhobenen Daten ab, die Relevanz des Effektes von der Indikation oder PatientInnenpopulation der Studie.
Literatur:
(1) Amer J Card 100,1254,2007
(2) Arch Int Med 166,797,2006
(3) Lancet 359,995,2002
(4) Psychiatry 6,21,2009
(5) N Engl J Med 344,1279,2001
(6) Arch Gen Psychiatry 54,1031,1997
(7) Blood 126,6,2015
(8) Stat Med 29,1,2010
(9) Ther Innov Regul Sci 49,155,2014
Update Obstipation
A. Chronische Obstipation:
Wir haben dieses Thema in der Pharmainfo XXVII/3/2012 besprochen und es seien hier nur einige zusätzliche Gesichtspunkte diskutiert. Primäre und wichtige Behandlungsmaßnahmen sind vermehrte physische Aktivität und Änderung der Essgewohnheiten (Ballaststoffe), wobei letzteres durch Quellmittel (Flohsamen: Agiocur, Agiolax, Pascomucil) ergänzt werden kann (siehe Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie: 1). Für osmotische Laxantien (Polyethylenglykol: PEG: Forlax, Laxogol, Molaxole, Movicol, Olopeg; Lactulose: Generika, Laevolac; Lactitol: Importal), für Natriumpicosulfat (Agaffin, Guttalax, Laxasan) und Bisacodyl (Dulcolax, Laxbene) ist die Wirkung gegenüber Placebo ausreichend belegt (1-4), für Anthrachinone bzw. Senna liegen nur einige ältere Studien vor (1,3).
Gibt es Unterschiede in der Wirksamkeit?
Auswertbare Vergleichsstudien liegen nur sehr wenige vor. Für den Vergleich PEG versus Lactulose (den in Deutschland, siehe Arzneimittelverordnungsreport, H. Schwabe, 2015 am meisten verschriebenen Laxantien) konnte aber ein Cochrane Review (5) 19 Studien mit insgesamt 868 PatientInnen auswerten. Diese Metaanalyse kam zum Schluss, dass PEG wirksamer ist. Dies beruhte allerdings auf marginalen Unterschieden z.B. einer durchschnittlichen Steigerung der Stuhlfrequenz durch PEG versus Lactulose von 0,65 pro Woche, was in der zweitgrößten Studie eine Zunahme von 6,43 auf 7,12 bedeutete.
Bei der Besprechung des neu zugelassenen 5-HT4-Rezeptor-Agonisten Prucaloprid (Resolor) haben wir festgestellt (Pharmainfo XXVII/3/2012), dass eine laxative Wirkung belegt ist, aber ein Vergleich mit den altbewährten Laxantien fehlt.
Inzwischen liegt eine Vergleichsstudie mit PEG vor (6). Diese Doppelblindstudie fand für den Primärparameter (Prozentsatz der PatientInnen mit mehr als 3 Stuhlentleerungen pro Woche) eine non-inferiority von PEG versus Prucaloprid (66,67 versus 56,52%), in einigen Sekundärparametern (wie z.B. Stuhlgewicht, level of straining, completeness of defecation) war PEG signifikant besser. Die Daten dieser Untersuchung erscheinen solide, sodass die Tatsache, dass es sich um eine Studie mit FirmenautorInnen (für PEG) handelt, sie nicht entwerten dürfte.
Vergleichsstudien von neu eingeführten Präparaten mit alten bewährten Mitteln werden meist nicht oder sehr spät durchgeführt. Verständlich, wenn das erhaltbare Resultat, so wie es in diesem Fall war, kein Argument liefert ein neues, noch wenig bewährtes und teures Präparat zu verwenden.
Zusammengefasst:
Am besten untersucht sind osmotische Laxantien PEG und Lactulose (wobei PEG als erste Wahl angesehen wird: 1,4,5), Bisacodyl und Natriumpicosulfat. Da aber keine wirklich schlüssigen Vergleiche vorliegen, sollte die Verschreibung bei den altbewährten Präparaten individuelle Gesichtspunkte der Wirkung und Verträglichkeit berücksichtigen und ökonomische Kriterien beachten.
B. Opioid-induzierte Obstipation: periphere Opioidrezeptor-Antagonisten – Update und Naloxegol (Moventig)
Chronische Obstipation ist eine häufige (10 bis >60%, 7-9) und oft therapielimitierende Nebenwirkung bei Therapie mit Opioid-Analgetika (opioid-induced constipation, OIC). Sie wird durch die Aktivierung von µ-Opioidrezeptoren an enteralen Neuronen vermittelt, wodurch die propulsive Darmmotorik gehemmt, die Darmtransitzeit verlängert, der Analsphinktertonus erhöht und die intestinale Flüssigkeitsresorption gesteigert werden. OIC beeinträchtigt die Lebensqualität und führt zu vermehrten Arztkonsultationen. Im Unterschied zur analgetischen Wirkung und Übelkeit ist eine klinisch relevante Toleranzentwicklung bei fortlaufender Therapiedauer nicht zu beobachten. Daher sollte, sofern andere Ursachen für eine Obstipation ausgeschlossen werden können, einer OIC vor allem bei Vorliegen weiterer prädisponierender Faktoren (wie Alter, Immobilität, Neuropathie, andere obstipierend wirkende Arzneistoffe) durch herkömmliche Maßnahmen (ballaststoffreiche Diät, Flüssigkeitszufuhr) und Standardlaxantien vorgebeugt werden (siehe 1). Dazu gehören in der Erstlinientherapie einzeln oder auch kombiniert vor allem die klassischen osmotischen Laxantien (siehe oben), aber auch Klysmen (1,10). Ein Teil der PatientInnen mit OIC sprechen allerdings ungenügend auf eine solche Erstlinientherapie an. Für diese stehen unter anderem Opioidrezeptor-Antagonisten zur Verfügung, welche durch fehlende ZNS-Penetration die analgetische Wirkung in therapeutischen Dosen nicht abschwächen (und auch keine Entzugsymptome auslösen), jedoch periphere Opioidwirkungen, wie Obstipation, vermindern (peripherally acting µ opioid receptor antagonists, PAMORAs).
Methylnaltrexon (Relistor)
Methylnaltrexon (Relistor) ist ein permanent geladenes Derivat des Opioidrezeptor-Antagonisten Naltrexon. Aufgrund seiner Ladung kann es die Blut-Hirnschranke nicht passieren und wird daher auch oral schlecht resorbiert. Es wird daher subcutan appliziert und ist peripher systemisch wirksam, wodurch alle Darmabschnitte erreicht werden. In klinischen Studien konnte daher auch eine gute Wirksamkeit nachgewiesen werden. Bei Erwachsenen mit fortgeschrittener Erkrankung kommt es bei 48-60% der PatientInnen innerhalb von 4 Stunden nach Applikation zu einer spontanen Defäkation (15% bei Placebo: 11,12; siehe auch Pharmainfo XXV/4/2010). Relistor stellt damit eine effektive, wenngleich sehr teure Therapieoption dar. Ursprünglich nur zugelassen für die Zweitlinientherapie von PatientInnen in fortgeschrittenem Krankheitsstadium, die eine palliative Behandlung erhalten (Pharmainfo XXV/4/2010), wurde die Indikation mittlerweile auf alle erwachsenen PatientInnen (ab 18 Jahre) mit OIC erweitert.
Berichte (2010: 13) über seltene Fälle von Darmperforationen unter Relistor-Therapie führten zur Warnung vor dieser Nebenwirkung in der Fachinformation, allerdings ist in der Zwischenzeit bis heute weder die Kausalität noch die Frequenz des Auftretens geklärt worden.
Naloxon zusammen mit Oxycodon (Targin)
Als PAMORA wirkt auch oral appliziertes Naloxon. Es unterliegt einem effizienten First-Pass-Metabolismus, sodass weniger als 3% der verabreichten Menge die systemische Zirkulation erreichen. Somit ist seine Wirkung auch auf den Ort der Freisetzung aus der Arzneiform beschränkt. In Österreich ist eine retardierte Fixkombination von Naloxon mit Oxycodon (Targin) erhältlich, die Zulassung erfolgte nicht zentral durch die europäischen Behörden.
Wir haben Targin bereits besprochen (Pharmainfo XXV/4/2010), daher seien hier nur einige Punkte diskutiert.
In einer Zulassungsstudie mit FirmenautorInnen (14) in PatientInnen mit chronischen Nicht-Karzinom-Schmerzen führte die Zugabe von Naloxon bis zu einer Dosis von 40 mg zu Oxycodon (80 mg) zu keiner Veränderung der analgetischen Wirkung. Bezüglich Darmwirkung reduzierte Naloxonzugabe zwar den Bowel Function Index (BFI: eine subjektive Bewertung der Darmfunktion wie „ease of defecation“) signifikant, der „härtere“ Parameter Stuhlgangfrequenz veränderte sich aber nur gering (in den letzten 7 Tagen der Doppelblindphase) von 0,9 pro Tag auf 1,1 mit Naloxon, der Laxantienverbrauch war in beiden Gruppen hoch (81% Placebo, 58% Naloxon: keine Statistik angegeben).
Bei der chronischen Therapie von KarzinompatientInnen muss die Oxycodondosis aufgrund der Toleranzentwicklung oft erhöht werden (bis zu 400 mg lt. Fachinformation). Wenn aber höhere Dosen der Kombination (bis zu 200 mg Naloxon/400 mg Oxycodon) verabreicht werden, reicht die First-Pass-Eliminierung von Naloxon nicht mehr aus, systemisch vorhandenes Naloxon kann dann die analgetische Wirkung reduzieren.
In einer Studie mit FirmenautorInnen (15) an KarzinompatientInnen wurde daher bei Bedarf zusätzlich zur Kombination Oxycodon bis zu 120 mg dazugegeben und zwar sowohl zur Oxycodon- als auch zur Oxycodon/Naloxon-Gruppe. Für die analgetische Wirkung wurde über 4 Wochen der Studie kein Unterschied in der Wirkung gefunden. Der BFI war für die Kombination zwar um 11,4 Punkte niedriger, auf einer 100-Punkte-Skala des BFI dürfte dies aber von fraglicher klinischer Relevanz sein. Für den verlässlichen und klinisch bedeutenderen Parameter Stuhlfrequenz wurden keine Angaben gemacht, der Laxantienverbrauch unterschied sich nicht signifikant (27,6 versus 32,7%).
In Österreich ist Targin bis zu einer Tagesmaximaldosis von 160 mg Oxycodon (80 mg Naloxon) zugelassen. Für diese hohen Dosen sind in den obigen Studien keine Daten enthalten. Die FDA (siehe USA Fachinformation) stellt fest: „Total daily doses above 80 mg/40 mg have not been studied sufficiently to ensure patient safety and may be associated with symptoms of opioid withdrawal or decreased analgesia.”
In den letzten Jahren sind weitere Publikationen zu Targin erschienen, vor allem mit FirmenautorInnen (z.B. 16–19) bzw. Firmensponsoring, die positive Resultate kommunizieren, aber die obigen Analysen nicht verändern. Aber es gibt Ausnahmen, in denen auch negative Resultate berichtet werden. So unterschied sich bei postoperativer Gabe Naloxon/Oxycodon bezüglich obstipierender Wirkung nicht von Oxycodon (20) und bei Schmerz von Parkinson-PatientInnen zeigte es keine signifikante analgetische Wirkung (21).
Zwei Publikationen verglichen Tapentadol (Palexia) und Targin und bewerteten Tapentadol als die bessere Substanz – in diesen Fällen waren allerdings AutorInnen der Tapentadol-Firma federführend beteiligt (22,23).
Wie soll man einen für Targin sehr positiven Review (23a) bewerten, dessen Autor „no conflict of interest“ angibt, der aber in einer Firmenstudie von Targin mit FirmenautorInnen (einschließlich des Korrespondenzautors) als Co-Autor angeführt ist (23b)?
Bei nahezu völligem Fehlen von Studien ohne FirmenautorInnen oder Sponsoring wird die Bewertung einer Substanz äußerst schwierig. Firmenstudien können, aber müssen natürlich nicht biased sein (siehe oben), eine Vergleichsmöglichkeit mit unabhängigen Studien ist aber auf jeden Fall essentiell.
Zusammenfassung:
Die vorliegenden Daten können nicht überzeugend belegen, dass Naloxon/Oxycodon klinisch relevante Vorteile gegenüber Oxycodon bezüglich der Obstipationsreduktion hat (vor allem durch eine Steigerung der Stuhlfrequenz). Ungeklärt ist auch, ob nicht eine individuell optimierte (und auch preislich günstigere) Laxantientherapie vergleichbar ist oder sogar bessere Resultate erzielt.
Hohe Dosen von Naloxon/Oxycodon sind nur bis 40/80 mg gut untersucht, bei KarzinompatientInnen muss daher bei Toleranzentwicklung zusätzlich Oxycodon gegeben werden, was zu einer unnötig komplexen Therapie führt.
Naloxegol (Moventig)
Naloxegol steht seit letztem Jahr als weitere Therapiealternative zur Verfügung. Es ist indiziert zur Behandlung von OIC bei erwachsenen PatientInnen, die unzureichend auf Laxantien angesprochen haben. Es handelt sich dabei um ein PEGyliertes Derivat des Naloxon. Durch diese chemische Modifikation wird seine passive Membranpermeabilität reduziert und es wird ein Substrat für einen Efflux-Transporter des Gehirns, das P-Glykoprotein Transportprotein. Beides verhindert eine relevante Penetration in das ZNS und limitiert seine Wirkungen auf das periphere Kompartiment (24). Naloxegol wird systemisch verfügbar und erreicht Plasmakonzentrationen, welche µ-Opioidrezeptoren in enteralen Neuronen blockieren. Die Metaboliten, als auch 16% der unveränderten Substanz, werden überwiegend im Stuhl ausgeschieden, sodass auch eine zusätzliche lokale Wirkung angenommen werden kann.
In zwei identischen doppel-blinden, randomisierten Phase-3-Studien (650 und 700 PatientInnen; USA und Europa: 24,25) wurden die Wirksamkeit und Sicherheit von 12,5 und 25 mg/Tag Naloxegol bei ambulanten Schmerz-PatientInnen mit OIC untersucht. PatientInnen mit tumorbedingten oder bestehenden Schmerzen unter Opioidtherapie und PatientInnen mit Darmobstruktion waren von der Studie ausgeschlossen. Standardlaxantien (Ausnahme: Bisacodyl als Rescue Laxans; dieses war auch während der gesamten Studie erlaubt) wurden 2 Wochen vor Studienbeginn abgesetzt. Primärer Wirksamkeitsendpunkt war die Responderrate nach 12-wöchiger Therapie. Als Responder zählten PatientInnen mit mindestens 3 spontanen Defäkationen pro Woche und einer Zunahme von mindestens einer spontanen Defäkation pro Woche in mindestens 9 der 12 Wochen und mindestens 3 der letzten 4 Wochen (intention-to-treat Population). Wichtiger sekundärer Endpunkt war unter anderem die Responderrate von PatientInnen, die früher nicht ausreichend auf Standardlaxantien angesprochen hatten (inadäquate Laxantienresponder). Naloxegol–Behandlung erhöhte die Responderrate von 29,3% unter Placebo auf 39,7% - 44,4% (NNT 6,6 bzw. 9,6 in den beiden Studien: 24,25). In der Gruppe der PatientInnen mit inadäquatem Response auf Standardlaxantien waren die NNTs etwas niedriger (5 bzw. 6,5). Die Zulassungsbehörde (24) sah für diese Daten in der Gesamtpopulation der PatientInnen keinen „clinically relevant effect“, eine Indikation wurde daher nur für PatientInnen mit inadäquatem Response auf Laxantientherapie zugelassen. Signifikante Schmerzscores und Opioiddosen wurden durch die Therapie nicht beeinflusst. 25 mg Naloxegol beschleunigten außerdem die mediane Zeit bis zum ersten Stuhlgang (5-12 Stunden vs. 36 Stunden unter Placebo) und verringerten den Anteil der PatientInnen, die mindestens einmal Bisacodyl einnehmen mussten (ca. 55% vs. 70% unter Placebo). Etwas mehr Naloxegol-behandelte PatientInnen brachen die Studie ab (ca. 10% vs. 5% unter Placebo), insbesondere wegen etwas häufigerer gastrointestinaler unerwünschter Wirkungen (Abdominalschmerzen, Diarrhoe, Übelkeit und Flatulenz). Bei längerer Anwendung (bis 52 Wochen: 26) waren diese Nebenwirkungen spontan oder nach Absetzen der Therapie reversibel.
Diese Studien bescheinigen Naloxegol eine bescheidene klinische Wirksamkeit bei gutem Sicherheitsprofil. Sie bestätigen aber auch die hohe Erfolgsrate (ca. 30%) einer Placebobehandlung in diesem PatientInnenkollektiv. Allerdings erlaubt die derzeitige Studienlage nicht, den wirklichen zusätzlichen Nutzen einer Zweitlinientherapie mit Naloxegol für die zugelassene PatientInnengruppe abzuschätzen. So lässt die Information zur Laxantien-Vortherapie in der Gruppe der PatientInnen mit inadäquatem Laxantienresponse keine Rückschlüsse zu, wie intensiv eine solche Therapie optimiert wurde (tatsächliche Dauer der Behandlung, Dosierung, Art der Laxantien). Ein inadäquater Response wurde lediglich definiert als in den beiden Wochen vor der ersten Studienuntersuchung von PatientInnen berichtete andauernde OIC-Symptome von mindestens mittelschwerer Intensität trotz Einnahme von mindestens einer Laxantien-Klasse an mindestens vier Tagen vor Studienbeginn. 15-20% der eingeschlossenen PatientInnen hatte in den letzten 6 Monaten überhaupt keine Laxantientherapie erhalten (25). Eine direkte, kontrollierte, doppel-blinde Vergleichsstudie in einer mit herkömmlichen Laxantien behandelten PatientInnengruppe wurde bis heute nicht publiziert. Weiters liegen noch keine Wirksamkeitsdaten für Tumor- PatientInnen vor (Studie aufgrund von Rekrutierungsproblemen abgebrochen: 24). Im Gegensatz zur EMA erteilte die FDA die Zulassung nur für PatientInnen mit "non-malignant pain".
Zusammenfassung:
Bei der Behandlung von nicht-tumorbedingten Schmerzen mit starken Opioiden stellt Naloxegol eine neue orale und relativ gut verträgliche Zweitlinientherapieoption dar. Allerdings spricht nur ein geringer Teil der PatientInnen auf diese Therapie an, sodass bei fehlendem Erfolg nach vier Wochen der Therapieversuch beendet werden sollte. Der tatsächliche Nutzen gegenüber einer optimierten individuellen Therapie mit kostengünstigeren Standardlaxantien oder als add-on Therapie ist nicht beurteilbar. Daher sollte eine Laxantientherapie entsprechend existierender Stufenschemata vor Beginn mit Naloxegol oder einem der anderen PAMORAs voll ausgeschöpft werden. Insbesondere sollte jedoch grundsätzlich vor allem bei chronischen, nicht-tumorbedingten Schmerzen der tatsächlich zu erwartende Nutzen einer längeren Therapie mit starken Opioiden überprüft werden (27).
Literatur:
(1) Z Gastroent 51,651,2013
(2) Gastroent 144,218,2013
(3) JAMA 315,185,2016
(4) Can J Gastroent Hep 28,549,2014
(5) Cochrane Database Syst Rev Issue 7,2014
(6) Aliment Pharmacol Ther 37,876,2013
(7) J Pain Palliat Care Pharmacother 23,231,2009
(8) J Opioid Manag 5,137,2009
(9) J Pain Res 8,289,2015
(10) Am J Gastroenterol 109,S2,2014
(11) J Support Oncol 7,39,2009
(12) N Engl J Med 358,2332,2008
(13) J Pain Sy Man 40,e1,2010
(14) Eur J Pain 13,56,2009
(15) Pall Med 26,50,2011
(16) Curr Med Res Opin 30,2389,2014
(17) Neurogast Motil 26,1792,2014
(18) Clin Drug Inv 35,1,2015
(19) Clin Ther 37,784,2015
(20) Acta Anaesth Scand 57,509,2013
(21) Lancet Neurol 14,1161,2015
(22) Pain Practica 2015: R. Baron
(23) MMW-Fortschr Med Orig 156,54,2014
(23a) Curr Drug Res 15,124,2014
(23b) Supp Care Canc 23,823,2015
(24) EPAR Moventig, EMA, London
(25) N Engl J Med 370,2387,2014
(26) Aliment Pharmacol Ther 40,771,2014
(27) S3 Leitlinie Langzeitanwendung von Opioiden bei nicht-tumorbedingten Schmerzen – "LONTS",2014
Morbus Menière und Betahistin (Generika und Betaserc)
Der Morbus Menière mit einer Häufigkeit von 200 Fällen/100.000 hat als Hauptsymptome Attacken von Schwindel, Tinnitus und Hörverlust, wobei diese im Verlauf der Zeit chronisch werden können, aber auch Reduktionen sind möglich (1). Seit langem wird Betahistin bei dieser Erkrankung verwendet. Im Jahr 1995 (Pharmainfo X/1) stellten wir für diese Substanz fest, dass „kein eindeutiger Wirkungsnachweis vorliegt!“ Im Jahr 2001 (2) fasste ein Cochrane Review, der die Wirkung bei Schwindel, Tinnitus und Hörverlust bewertete, zusammen: „The review did not find enough evidence to show whether betahistin is helpful“ (bestätigt im Jahre 2011: 3). Es gab aber auch positivere Bewertungen (siehe 4). Die zwei rezentesten Analysen (1,5) sahen eine Wirkung von Betahistin als nicht belegt. Als Nebenwirkungen sind Nausea, Kopfschmerzen, Lethargie, Bronchospasmus (Asthma) und Magengeschwüre beschrieben (siehe 5).
In zwei Publikationen (1,4) wurde auf eine laufende Studie hingewiesen, von der für die Wirkung „eine Klärung zu erwarten ist“. Diese ist nun durch die Publikation dieser Studie (6) erfolgt.
Es handelte sich um eine Doppelblindstudie, in der PatientInnen mit Morbus Menière (n = 221) über 9 Monate in drei Gruppen (Placebo, 2 x 24 mg und 3 x 48 mg Betahistin) verglichen wurden. Der Primärparameter (Zahl der Schwindelattacken pro 30 Tage in den letzten 3 Monaten) unterschied sich in den 3 Gruppen nicht (2,7 für Placebo, 3,2 und 3,3 für Betahistin). Auch für weitere Parameter wie Tinnitus, Hörreduktion und Lebensqualität wurde keine Wirkung beobachtet.
Betahistin ist also keine wirksame Dauertherapie für den Morbus Menière. Für eine dauerhafte Verbesserung verbleiben Methoden wie Intratympanale Gentamycin-Therapie und die noch weniger gut belegte Intratympanale Glukokortikoid-Applikation (siehe 1).
Für die symptomatische Behandlung kann der Schwindel mit Antihistaminika (siehe Pharmainfo XXVI/1/2011) sowie Dimenhydrinat (Vertirosan, plus Cinnarizin: Arlevert; plus Coffein: Neoemedyl; Cyclizin: Echnatol), Nausea und Erbrechen mit Antiemetika behandelt werden. Für Tinnitus gibt es keine belegt wirksamen Medikamente, auch hier müssen andere Therapien (siehe Pharmainfo XXVII/1/2012) in Erwägung gezogen werden.
Bemerkenswert ist, wie viele Jahre nach der Markteinführung einer Substanz erst eine klare Aussage über die Wirkung getroffen werden kann. Trotzdem wird seit Jahren Betahistin häufig verschrieben (in Deutschland 2014 60,5 Mio Tagesdosen: Arzneimittelverordnungsreport: U. Schwabe, 2015). Offensichtlich und eigentlich auch verständlicherweise werden beim Fehlen einer gut belegten Therapie auch fragliche Medikamente verschrieben.
Jetzt stellt aber ein Editorial zu obiger Studie fest (7): “This trial could be the trigger that diverts both patients and doctors away from this popular but ineffective treatment. This will at least protect patients from the drug’s side effects. It might also allow a relocation of resources to search for better alternatives”. We agree.
Literatur:
(1) Lar Rhin Otol 94,530,2015
(2) Cochrane Database Syst Rev 2001,CD001873
(3) Cochrane Database Syst Rev, The Cochrane Library, Issue 3, 2011
(4) Curr Opin Neurol 26,81,2013
(5) Audiol Neurotol 20,153,2015
(6) BMJ 352,h6816,2016
(7) BMJ 352,i46,2016
P.b.b. Erscheinungsort Verlagspostamt 1010 Wien
Montag, 1. August 2016
Pharmainformation
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.



