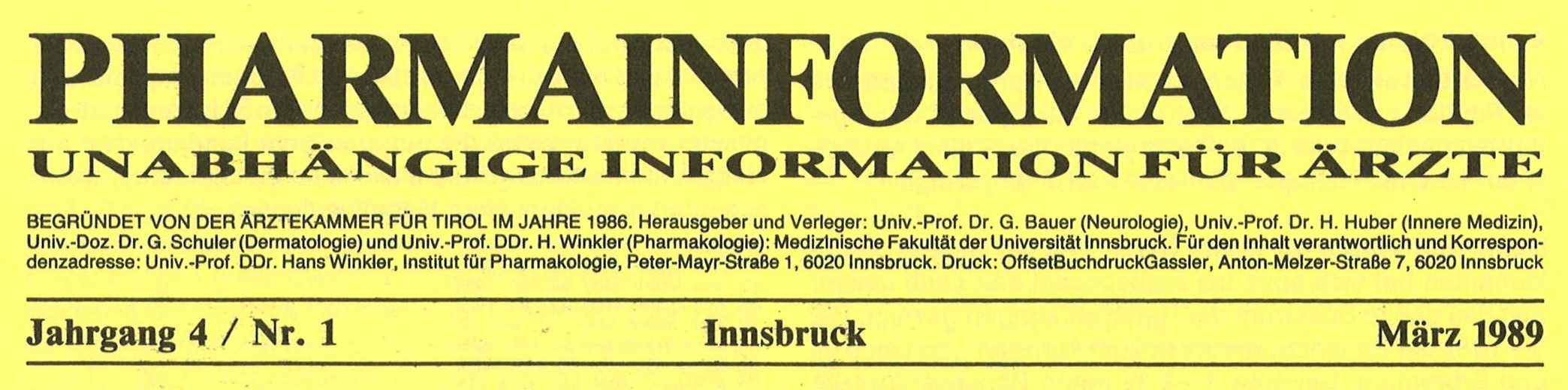
Inhalt
- Ketoconazol (Nizoral)
- Leseranfrage: Estraderm
- Mesalazin (Claversal, Salofalk)
- Naturheilmittel und Schulmedizin: Phytodolor
Indikationsstellung für Ketoconazol (Nizoral):
Ketoconazol ist ein Imidazolderivat, das durch Hemmung der Ergosterolsynthese eine fungiastische Wirkung auf ein breites Spektrum von Pilzen ausübt. Ketoconazol kann oral oder topisch verabreicht werden.
Orale Therapie
Bei der oralen Therapie von Ketoconazol ist zu bedenken, daß die Absorption der Droge von der Umwandlung in ein Salz im sauren Milieu des Magens abhängt. Anacide Patienten bedürfen daher einer HCI-Substitutionstherapie. Bei Verwendung von Antacida oder H2-Blockern ist eine orale Resorption nicht gewährleistet.
Indikationen
1. Systemische/tiefe Pilzinfektionen
Die Substanz wurde unter anderem erfolgreich zur Behandlung der (Para)Coccidioidomykose, Histoplasmose und Chromomykose eingesetzt. Die Möglichkeit der oralen Verabreichung und die im Vergleich zu den anderen zur Bekämpfung systemischer Pilzinfektionen zur Verfügung stehenden Medikamenten geringen Nebenwirkungen sind hier von Vorteil (1). Ketoconazol passiert die Blut-Hirnschranke schlecht und muß sehr hoch dosiert werden (800-1.200 mg/die), um im ZNS therapeutische Spiegel zu erreichen (2). Ketoconazol ist bei Pilzinfektionen des Harntraktes kaum effektiv, da nur wenig aktive Substanz im Urin ausgeschieden wird. Bei invasiven Pilzinfektionen bei immunsupprimierten Patienten ist Ketoconazol nicht das Mittel erster Wahl, da es weniger effektiv ist als Amphotericin (Ampho-Moronal, Amphotericin B.z. Inf.) oder Flucytosine (Ancotil).
2. Candidainfektionen
Ketoconazol ist das Mittel der Wahl zur suppressiven Therapie bei chronisch mukokutaner Candidiasis (3). Es wird auch zur Behandlung der Candidaösophagitis bei AIDS-Patienten eingesetzt. Ketoconazol kann prophylaktisch bei neutropenischen Patienten eingesetzt werden, die routinemäßige Applikation hat sich allerdings nicht durchgesetzt (4). Kutane Candidainfektionen können bei immunkompetenten Patienten fast immer durch topische Antimykotika gut behandelt werden. Der Einsatz von Ketoconazol ist nur selten notendig, ein Beispiel wäre eine auf austrocknende Behandlung und spezifische Lokaltherapie nicht ansprechende Candidaparonychie. Für die Behandlung und Rezidivprophylaxe der Candidavaginitis reicht in den allermeisten Fällen ebenfalls eine Lokaltherapie aus. Prädisponierende Faktoren müssen berücksichtigt werden (Schwangerschaft, Kontrazeptiva, Antibiotikagabe, Diabetes mellitus, Befall des Magen-Darm-Traktes infolge Hypazidität). Wenn eine stärkere Besiedelung des Darmtraktes mit Candida albicans vorliegt, sollte diese zusätzlich durch orale Gabe des nicht resorbierbaren Nystatin (Mycostatin) behandelt werden. Zusätzlich gibt es eine kleine Subgruppe von Patientinnen, die unter schwerer, häufigrezidivierender oder gar persistierender Candidavaginitis leiden, die zu einer schweren Beeinträchtigung u.a. auch des Sexuallebens führt. Meist liegen die oben angeführten prädisponierenden Faktoren nicht vor, die Pathogenese ist unklar (?Versagen der lokalen Abwehrmechanismen), die übliche Therapie erfolglos. Die Neigung zur Candidavaginitis kann zwar nicht beseitigt werden, durch zyklische Gabe von lokalen Antimykotika (5) oder Ketoconazol (6,7) können aber die Erscheinungen supprimiert werden. Eine prospektive plazebokontrollierte Studie (7) zeigte, daß die kontinuierliche tägliche Prophylaxe mit Ketoconazol am effektivsten die Candidavaginitis supprimierte. Rezidive nach Absetzen des Medikaments waren aber auch häufig. In dieser Studie wurden 74 Patientinnen durch zwei Wochen mit 400 mg Ketoconazol täglich behandelt, danach randomisiert auf drei Gruppen (a,b,c) aufgeteilt. Sie erhielten über sechs Monate bzw. Zyklen: (a) Plazebo, (b) jeweils ab Einsetzen der Menstruation durch fünf Tage 400 mg Ketoconazol täglich, (c) 100 mg Ketoconazol täglich durch sechs Monate. Nach sechs Monaten hatten in Gruppe (a) 71%, in (b) 29%, in (c) 5% ein Soorrezidiv. Nach zwölf Monaten waren 24% der Plazebogruppe rezidivfrei, 43% der Gruppe (b), 52% der Gruppe (c).
3. Dermatophyteninfektionen
Soferne eine systemische Therapie indiziert ist (sehr ausgedehnte Trichomykosen sowie - unter Vorbehalt, siehe unten - Onychomykosen) ist nach wie vor Griseofulvin (Fulcin, Griseomed, Grisovin) das Mittel erster Wahl. Griseofulvin hat sich in den 30 Jahren seines Gebrauchs als sichere und effektive Therapie herausgestellt. Ketoconazol ist als Alternative bei einer Griseofulvinunverträglichkeit in Betracht zu ziehen oder wenn chronische Dermatophyteninfektionen auf Griseofulvin nicht ansprechen. Dieses Problem stellt sich vor allem bei den Onychomykosen. Eine große Studie hat gezeigt, daß mit den beiden Substanzen nur in etwa 20% der Fälle eine Heilung von Nagelpilzinfektionen zu erwarten ist, da Rückfälle häufig sind (8). In einer anderen Studie zeigte sich, daß bei Versagen von Griseofulvin auch Ketoconazol meist keinen Erfolg brachte (9). Ganz allgemein erscheint es sinnvoll, Onychomykosen bei älteren Patienten mit prädisponierenden Faktoren (chron. venöse Insuffizienz etc.) nur lokal (Harnstoffsalbe zur Entfernung der befallenen Nagelsubstanz, anschließend Applikation von Imidazol-(Miconazol: Daktarin-Lösung, Econazol: Pevaryl, Clotrimazol: Canesten) oder Allylamin-(Exoderil) Präparaten) palliativ zu behandeln. Bei jüngeren Patienten ist hingegen eine systemische Therapie sinnvoll.
4. Infektionen mit Pityrosporum orbiculare
Nur bei den seltenen Fällen von sehr schwerer, ausgedehnter Pityriasis versicolor, die auf eine sachgemäß durchgeführte Lokaltherapie (z.B. Pevarylshampoo) nicht ansprechen, ist eine Therapie mit Ketoconazol angezeigt.
Nebenwirkungen bei oraler Gabe:
Wie bei anderen Medikamenten hat sich auch bei Ketoconazol erst nach einiger Zeit das ganze Spektrum der Nebenwirkungen gezeigt. Bei 3-10% der Patienten kommt es zum Auftreten von Übelkeit und Erbrechen. Bei etwa 1-2% treten Bauchschmerzen und Juckreiz (ohne Ausschlag) auf. Bei etwa 5 - 10% der Patienten kommt es zu irgendeinem Zeitpunkt während der Behandlung mit Ketoconazol zu einer Erhöhung der Transaminasen, die transient und klinisch inapperent ist. Selten kommt es zu Auftreten einer symptomatischen, ikterisch oder anikterisch verlaufenden Hepatitis (Inzidenz etwa 1 in 10.000, aufgrund der Dunkelziffer wahrscheinlich höher; vielleicht bei älteren Frauen häufiger auftretend, meist in den ersten zwei Monaten, evtl. bereits in den ersten zwei Wochen der Verabreichung von Ketoconazol (11-13). Diese nicht dosisabhängige, wahrscheinlich eine "idiosynkratische" Reaktion darstellende Hepatitis verlief in einzelnen Fällen letal (wahrscheinlich weil Ketoconazol trotz Anzeichen der Hepatitis vorerst weiter verabreicht wurde). Ketoconazol unterdrückt nach einer Einzelgabe vorübergehend und dosisabhängig die Testosteronsynthese und die Steroidproduktion in der Nebenniere (14). Längerdauernde Therapie kann daher zur Gynäkomastie (15) und bei Verwendung hoher Dosen (Tagesdosis ab 400 mg) zu einer herabgesetzten Streßreaktionsfähigkeit führen. Selten kommen reversible Zyklusstörungen bzw. Libido- und Potenzabnahme vor. Der endokrinologische Effekt wurde auch bereits therapeutisch ausgenützt (Prostatakarzinom, Hyperadrenalismus). Allergische Reaktionen wurden beschrieben, in zwei Fällen eine anaphylaktische Reaktion nach einer einzigen Dosis von Ketoconazol (16). Interaktionen von Ketoconazol mit anderen Medikamenten sind zu beachten (Erhöhung des Blutspiegels von Cyclosporin, Potenzierung der Wirkung oraler Antikoagulantien: 17). Ketoconazol darf während der Schwangerschaft nicht verabreicht werden (teratogene Effekte im Tierversuch). Patienten, die Ketoconazol erhalten, sollten Alkohol meiden, da vereinzelt eine Disulfiram (Antabus)-ähnliche Wirkungbeobachtet wurde.
Topische Therapie
Ketoconazol ist bei topischer Applikation wirksam gegen Hefe- und Fadenpilzerkrankungen. Die Effektivität einer 2%igen Creme bei Pityriasis versicolor wurde in einer Doppelblindstudie nachgewiesen (10). Die topische Applikation scheint auch bei seborrhoischem Ekzem therapeutisch wirksam zu sein. Ein topisches Ketoconazolpräparat ist bei uns jetzt erhältlich (Nizoral-Creme).
Ketoconazol aus der Sicht des praktischen Arztes
Ketoconazol ist ein wichtiges Medikament zur Behandlung von a) bestimmten systemischen/tiefen Mykosen sowie b) kutanen Mykosen bei immundefizienten Patienten. Aufgrund der seltenen, aber gefährlichen Leberschädigung ist orales Ketoconazol kein Medikament für banale Pilzinfektionen, wird aber dennoch viel zu häufig hiefür verschrieben. Die Behandlung kutaner Mykosen mit Ketoconazol bei immunkompetenten Patienten erscheint aber nur in Ausnahmefällen angezeigt, die Indikation hiezu sollte vom Facharzt gestellt werden.
Obwohl die schweren Lebernebenwirkungen nach Gabe von oralem Ketoconazol (Nizoral) selten auftreten, muß dieses Risiko bedacht werden. Es ist angezeigt, die Transaminasen und die alkalische Phosphatase im Serum während der ersten zwei Monate alle zwei Wochen und dann alle ein oder zwei Monate zu kontrollieren. Die Substanz muß abgesetzt werden, wenn die Leberenzyme kontinuierlich ansteigen und/oder der Patient klinische Zeichen einer ikterischen oder anikterischen Hepatitis entwickelt.
Literatur:
(1) Ann. Intern. Med. 98, 13, 1983
(2) Ann. Intern. Med. 98, 160, 1983
(3) Ann. Intern. Med. 93, 791, 1980
(4) Arch. Intern. Med. 144, 549, 1984
(5) Br. J. Vener. Dis. 54, 176, 1978
(6) Obstet. Gynecol. 65, 435, 1985
(7) N. Engl. J. Med. 315, 1455,1 986
(8) Br. J. Dermatol. 112, 691, 1985
(9) Clin. Exp. Dermatol. 7, 611, 1982
(10) J. Amer. Acad. Dermatol. 15, 500, 1986
(11) Brit. Med. J. 283, 825, 1981
(12) Gastroenterology 86, 503, 1984
(13) Brit. Med. J. 294, 419, 1987
(14) Arch. Intern. Med. 144, 2150, 1984
(15) Arch. Intern. Med. 145, 1429, 1985
(16) Brit. Med. J. 287, 1673, 1983
(17) FDA Drug Bull. 14, 17, 1984
Leseranfrage:
Wir freuen uns darüber, eine sehr akutelle Anfrage über ein neu registriertes Präparat beantworten zu können. Nach einer längeren Ausführung können wir uns am Ende dem letzten Satz der Anfrage von Primarius Dr. Menschick (Grieskirchen, OÖ) anschließen, der folgendes schreibt: "Ersuche höflich um Auskunft über das Präparat ESTRADERM, das seit einigen Monaten auch in Österreich registriert ist. Für dieses Präparat wird angeführt, daß die Nebenwirkungen kaum erwähnenswert sind, ein Umstand, der mir bei der hohen Dosierung doch fragwürdig erscheint. Bevor ich mich zur Verschreibung dieses Präparates entschließe, ersuche ich höflich um eine kurze Mitteilung zum erwähnten Medikament. Meines Erachtens sind dzt. erprobte Östriol-Präparate und Estradiol-Östriol-Gestagen-Tabletten im Handel, so daß im vorliegenden Indikationsbereich eigentlich ein dringender Bedarf an Analogem nicht unbedingt besteht."
Estraderm TTS: transdermale Östrogentherapie
Estraderm TTS, das vor kurzem in Österreich registriert wurde, ist ein Membranpflaster, das auf die Haut geklebt wird und dort kontinuierlich Östradiol zur transdermalen Resorption freigibt. Je nach Größe des Pflasters wurden 0,025, 0,05 und 0,1 mg Östradiol pro Tag freigesetzt. Alle 3 - 4 Tage soll ein neues Pflaster auf die Haut aufgebracht werden. Klinische Studien (z.B. 2, siehe 1a) belegen, daß Östradiol durch die Haut resorbiert wird. Bei dieser transdermalen Route entfällt im Gegensatz zur oralen Therapie die erste Leberpassage, wodurch transdermal niedrigere Dosen notwendig sind (ca. 100 mg transdermal versus 1 mg oral), um vergleichbare Blutspiegel zu erreichen. Dementsprechend ist bei der transdermalen Resorption der Blutspiegel des LeberMetaboliten des Östradiol, des Östron, niedriger (2).
Eine wichtige Indikation für die Östrogentherapie stellen Beschwerden in der Menopause wie Hitzewallungen und trophische Störungen der Vagina und des Uterus dar. Die Wirkung von transdermalem Östrogen in der Behandlung dieser Symtpome ist durch mehrere Studien gut belegt (2, 2a, siehe 1, 1a, 3, 3a), sie ist besser als bei Placebogaben und vergleichbar der Wirkung oraler Präparate. Für weitere Effekte gibt es gewisse Unterschiede: Im Gegensatz zur oralen Gabe wird nach transdermalen Östrogenen keine erhöhte Synthese von Lebereiweißen (z.B. hormonbindenden Globulinen, Reninsubstrat) gefunden (2, 2a). Ob der Anstieg des Reninsubstrates, wie er nach oraler Therapie auftritt, die Tendenz zur Blutdrucksteigerung bei Östrogengabe erklären kann, ist allerdings fraglich.
Orale Östrogene führen zu einer günstigen Beeinflussung des Lipoproteinmusters im Blut, während transdermale Östrogene hier ohne Effekt bleiben (2). Ob dies von Bedeutung ist, bleibt ebenfalls umstritten. Es liegen widersprüchliche Ergebnisse darüber vor, ob in der natürlichen Menopause Östrogengabe die Koronarmortalität von Frauen senkt (5), auf jeden Fall führt aber orale Östrogenzufuhr bei Frauen nach Ovarektomie (vielleicht über den gerade erwähnten Lipoproteineffekt) zu einer deutlichen Senkung der koronaren Erkrankungen (einschließlich tödlicher Herzinfarkte).
Während Östrogen im Rahmen einer antikonzeptiven Gabe zu thromboembolischen Komplikationen führen kann, ist dies für die Östrogensubstitution im Klimakterium derzeit nicht belegt (3). Weder orales noch transdermales Östrogen führt hier zu Veränderung von Gerinnungsfaktoren (2). Hingegen ist eine erhöhte Inzidenz von Endometriumcarcinomen nach länger dauernder alleiniger Östrogenzufuhr im Klimakterium gut belegt. Das Risiko soll bis auf das 10fache steigen (6,7), so daß durch diese Therapie das jährliche Risiko, an Endometriumcarcinom zu erkranken, 1 - 3(!)% betragen soll (9). Durch eine wohl zu freizügige Östrogentherapie in den siebziger Jahren dürfte bei vielen Frauen diese gravierende Nebenwirkung induziert worden sein. Inzwischen hat man erkannt, daß dieses Risiko durch eine zyklische Östrogen/Progesterongabe zu beherrschen ist (7a). Bei entsprechender Indikation ist daher eine solche Östrogentherapie im Rahmen der Menopause zweckmäßig. Bei dieser Therapieform kommt es bei vielen Frauen zu Abbruchblutungen, während bei einer reinen Östrogentherapie fallweise Durchbruchblutungen auftreten (3,10).
Eine alleinige dauernde Östrogentherapie, sei es oral oder transdermal, ist bei bei Frauen nach Hysterektomie vertretbar. Bei der transdermalen Therapie (für jeweils drei Wochen) wird daher für die letzten 10-12 Tage ein orales Gestagenpräparat zugegeben. Die als Vorteil hervorgestrichene bequeme Anwendung des Pflasters wird dadurch zu einer eher komplizierte transdermalen/Oralen Kombinationstherapie (8). Es ist zu befürchten, daß die Compliance der Patientinnen für diese zusätzliche orale Gestagengabe schlecht sein wird, mit der Folge einer reinen transdermalen Östrogenverabfolgung mit erhöhtem Carcinomrisiko. Dies erscheint als eine voraussehbare negative Entwicklung, die einen ernsten Einwand gegen die generelle Verwendung des transdermalen Systems bei Frauen mit intaktem Uterus darstellen könnte. Ob das transdermale System sich so wie die orale Östrogengabe auch in der wichtigen Prophylaxe und Therapie der postmenopausalen Osteoporose bewährt, ist ebenfalls noch zu klären (3a,4,8).
Wie bei allen Heftpflastern kann es bei Estraderm zu Hautreizungen und/oder Kontaktdermatitis kommen. Angaben über die Zahl der Patientinnen, die deswegen die Therapie abbrachen, variieren von 1 bis 8% (1,8,3a). Ob dieses Problem bei häufiger und längerer Anwendung außerhalb der kontrollierten Studien verstärkt auftritt, wird sich erst zeigen müssen.
Zwei kritische Publikationen stellen zu Estraderm fest:
"Estraderm verteuert die Behandlung erheblich und birgt bei kunstgerechter phasischer Kombination mit einem Gestagen Unbequemlichkeiten. Die FDA sieht in der 1986 in den USA zugelassenen Neuerung keinen nennenswerten Vorteil" (8).
"Es fällt deshalb schwer, Argumente zu finden, welche die mit einer erheblichen Verteuerung verbundene transdermale Östrogensubstitution rechtfertigen würden" (1).
Aufgrund des oben Gesagten seien noch drei Fragen an den Schlußgestellt: Wie wird das Risiko des Endometriumcarcinoms sein, wenn die Frauen die unbequeme kombinierte transdermale/orale Therapie nicht konsequent durchführen? Warum soll man ein neues, teures System verwenden, wenn die Wirkung bei Osteoporose und die Beeinflussung der Coronarmortalität noch nicht sichergestellt sind? Ist es wirklich zweckmäßig, bewährte Therapien zu verlassen, wenn eine neue Verabreichungsform keine wirklich entscheidenden Vorteile, möglicherweise sogar Nachteile, bringt?
Literatur:
(1) Pharmakritik 8, 17, 1986
(1a) Mün. Med. Wschr. 130, Sondernummer S1-76,1988
(2) N. Engl. J. Med. 314, 1615, 1986
(2a) Amer. J. Obstet. Gynecol. 156, 1326, 1987 (siehe auch Mün. Med. Wschr. 130, S15, 1988
(3) Drugs 33, 95, 1987
(3a) Drugs 36, 383, 1988
(4) Arzneiverordnung 6, 61, 1987
(5) N. Engl. J. Med. 316, 105, 1987
(6) N. Engl. J. Med. 300, 218, 1979
(7) N. Engl. J. Med. 313, 969, 1985
(7a) Brit. Med. J. 298, 147, 1989
(8) Arzneitelegramm S36, 1988
(9) Adverse Drug Bull. 126, 472, 1986
(10) Amer. J. Obstet. Gynecol. 152, 1079, 1985
Neu registrierte Präparate: Mesalazin (Claversal, Salofalk)
Die Indikation dieser Substanz liegt bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, insbesondere der Colitis ulcerosa. Mesalazin ist der Kurzname für 5-Aminosalicylsäure. Diese Verbindung ist auch im bereits lange bei Colitis ulcerosa verwendeten Salazosulfapyridin (Salazopyrin) enthalten und wird im Darm aus dieser Verbindung zusammen mit dem Sulfonamid Sulfapyridin freigesetzt.
Nebenwirkungen des Salazosulfapyridins waren zumindest teilweise auf die Sulfonamidkomponente zurückzuführen, während Mesalazin mehr für die Wirkung verantwortlich schien. Daher wird nun die Monokomponente Mesalazin eingesetzt (1,2).
Zur Bewertung dieser Substanz sei ein Kommentar aus der unabhängigen Schweizer Pharma-Kritik (2) zitiert: "Die - spärlichen - bisherigen Studienergebnisse lassen annehmen, daß Mesalazin (Claversal, Salofalk) für die Therapie und Rezidivprophylaxe der Colitis ulcerosa so wirksam ist wie Sulfasalazin (Salazopyrin), ein positiver Effekt beim Morbus Crohn ist bislang nicht gesichert. Zudem wird Mesalazin offenbar von einigen Patienten besser vertragen als die Standardsubstanz. Solange aber ein Patient Sulfasalazin gut toleriert, ist es nach der heutigen Einschätzung nicht sinnvoll, zur Rezidivprophylaxe auf eines der neuen Präparate zu wechseln. Kontrollierte Vergleichsstudien mit Sulfasalazin sind kaum vorhanden, und angesichts der Hinweise aus Tierversuchen ist zu wenig untersucht, wie sich eine längerdauernde Erhaltungstherapie mit Mesalazin auf die Nieren auswirkt. Diese Vorbehalte gelten weniger für die rektalen Mesalazin-Verabreichungsformen, die bei akuten Colitis-ulcerosa-Schüben eine wertvolle Alternative zu Sulfasalazin zu sein scheinen.
Literatur:
(1) Medical Letter 30, 53, 1988
(2) Pharma-Kritik 10, 17, 1988
Naturheilmittel versus Schulmedizin
Im folgenden werden zwei neu registrierte Naturheilmittel (Phytodolor: nächste Pharmainfo: Zintona) diskutiert. In diesem Zusammenhang sollen einige Bemerkungen zu der häufigen Behauptung gemacht werden, die Schulmedizin sei nicht an Naturheilmitteln interessiert. Diese Behauptung ist vor allem deswegen ungerechtfertigt, weil zahlreiche unserer wichtigsten Medikamente aus der Natur kommen. Denken wir nur an Morphin, Curare, die Herzglykoside, Reserpin und die meisten Antibiotika. Wann immer irgendwo in der Natur eine aktive Pflanze oder ein Pilz gefunden wurden, hat seit vielen Jahrzehnten die pharmazeutische Industrie versucht, das Wirkungsprinzip zu definieren und isolieren. Beim heutigen Konkurrenzdruck am Pharmamarkt ist anzunehmen, daß eine solche Suche sehr effektiv war und ist und gerade für neue Antibiotika sind z.B. unzählige Bodenproben auf Wirkstoffe enthaltende Pilze untersucht worden.
Wenn eine Pflanze bei einer Erkrankung eine belegte Wirkung entfaltet, dann ist zu fordern, daß der Wirkstoff extrahiert, konzentriert und schließlich definiert wird, wie das bereits so oft geschehen ist. Damit erreicht man zweierlei: eine Wirkungsverstärkung, da das Agens rein vorliegt und damit höher dosiert werden kann, ohne daß man Nebenwirkungen von zusätzlich vorhandenen Stoffen fürchten muß. Weiters erzielt man eine verläßliche Dosierungsmöglichkeit: wenn nur ein Pflanzenextrakt zur Verfügung steht, ohne daß man den Wirkstoff genau kennt, kann z.B. niemand garantieren, daß je nach Standort der Pflanze und anderen nicht kontrollierbaren Veränderungen bei der Extraktion der Wirkstoff im Endprodukt in jeweils gleicher Konzentration vorliegt. Daher würde heute niemand mehr Digitalisblätterpulver zur Herztherapie verwenden. Wenn also heute ein sogenanntes Naturprodukt auf den Markt kommt, zeigt dies, daß die produzierende Firma ihre Aufgabe noch nicht erfüllt hat. Vor allem kann man den Verdacht nicht entkräften, daß vielleicht gar kein definierter Wirkstoff in diesem Mittel enthalten ist und die Wirkung sich nicht einmal sicher belegen läßt. Wir haben so viele gute Medikamente aus der Natur erhalten, es werden sicherlich noch mehr werden, nur müssen diese neuen Mittel einer kritischen Überprüfung standhalten.
Es wird auch immer wieder behauptet, Naturheilmittel fallen durch geringe Nebenwirkungen auf. Allerdings wird das Nebenwirkungspotential von Pflanzen und Tees immer wieder unterschätzt und Vergiftungen sind nicht so selten (siehe bei 1. Eichler, ÖÄZ 39, 869, 1984). Wenn aber behauptet wird, eine Substanz wäre gegen eine Erkrankung wirksam, hätte aber absolut keine Nebenwirkungen, dann ist größte Skepsis angebracht. Jede Wirkung ist nun einmal ein Eingriff in ein biologisches System und kann daher durch dessen Veränderung auch unerwünschte Wirkungen, also Nebenwirkungen hervorrufen. Der Grundsatz, daß Substanzen ohne Nebenwirkungen auch kaum wirken können, ist durch eine lange Erfahrung belegt.
Bei der Bewertung der folgenden neu registrierten Präparate war auffällig, daß vor allem nur unveröffentlichte Studien vorlagen, um die Wirkung zu beweisen. Solche Studien sind weniger verläßlich, da der Autor erst bei der Veröffentlichung, vor allem bei guten Zeitschriften, der Kritik durch Kollegen und Editors ausgesetzt wird. Weiters legt er sich bei der Publikation öffentlich fest und geht das Risiko ein, daß er durch falsche Daten seinen Ruf als Wissenschaftler oder Arzt schädigt. Daher zeigt sich immer wieder, daß für gute Medikamente zahlreiche publizierte Studien die Wirkung belegen. Es erschiene uns sehr zweckmäßig, wenn die Registrierungsbehörde im Rahmen des Zulassungsverfahrens besonders auf veröffentlichte Studien bestände.
Phytodolor
Dieses als Antirheumaticum zugelassene Präparat enthält einen alkoholischen Extrakt aus Eschenrinde, Zitterpappelblatt und Goldrutenkraut. Das Pappelextrakt ist auf 1,25 mg/ml Salicylalkohol standardisiert, die Eschenrinde auf Isofraxidin (1,0 mg/ml), bei Goldrutenkraut ist keine Standardisierung angegeben. Analgetische und antiphlogistische Wirkungen werden auf Salicin und Flavonoide in diesen Pflanzen zurückgeführt. Salicin soll über Salicylalkohol zur Salicylsäure führen, deren antiphlogistische Wirksamkeit bekannt ist. Bei der Therapie mit bis zu 4 ml werden aber nur bis zu 5 mg Salicylalkohol zugeführt. Die therapeutisch wirksamen Dosen von Salicylsäure liegen aber im g-Bereich, wobei dann allerdings auch die charakteristischen Nebenwirkungen dieser Substanz (z.B. Magenbelastung) auftreten. Es ist also ein eklatanter Widerspruch in der Argumentation für Phytodolor, daß Salicin eines der wirksamen Prinzipien darstellen soll, Nebenwirkungen bei diesem Präparat eher nicht beobachtbar seien. Tatsächlich sind bei der in diesem Präparat vorhandenen Konzentration von Salicylalkohol weder Wirkung noch Nebenwirkungen zu erwarten. Es wird behauptet, daß Phytodolor im Tierversuch deutlich antiphlogistische Effekte zeigte, und zwar als Kombination besser als bei Testung der Einzelkomponenten (welche?), worüber allerdings keine bewertbaren veröffentlichten Daten vorliegen. Wenn Salicylalkohol aufgrund der niederen Konzentration nicht der Wirkstoff sein kann, dann müssen also, wenn tatsächlich eine Wirkung auftritt, andere Wirkstoffe vorliegen. Diese sind nicht definiert, pharmakologisch bleibt also eine mögliche Wirkung dieses Präparates obscur. Wie ist nun die klinische Wirksamkeit zu bewerten? Hier wurden von den Firmen mehrere Stellungnahmen und Berichte vorgelegt, allerdings ist nur sehr wenig objektiv Auswertbares dabei. Eine im Forum Dr.med. veröffentlichte Studie von S. Speders (Heft 7-8, 1988) ist ohne Vergleich mit Placebo oder einer anderen Substanz durchgeführt und daher nicht aussagekräftig.
Eine weitere unveröffentlichte Studie (W. Schadler) testete doppelblind die zusätzliche Einnahme von Diclofenac in einer Phytodolor- bzw. Placebogruppe. In der ersten Woche war der Verbrauch von Diclofenac in der Phytodolorgruppe 26 Tabletten, in der Placebogruppe 35, was als signifikante Wirkung von Phytodolor dargestellt wurde. In der zweiten Woche wurde allerdings ein cross-over durchgeführt. Am Ende war der Tablettenkonsum in der Phytodolor- und Placebogruppe mit 22 und 23 praktisch ident. Da nicht anzunehmen ist, daß Phytodolor länger als eine Woche wirkt, unterstützen die Daten in der zweiten Woche nicht das Vorliegen einer Phytodolorwirkung. In einer weiteren Studie von F. Schreckenberger wurden bei Epicondylitis lateralis die Wirkungen von Phytodolor und Placebo (doppelblind) und von Diclofenac (einfachblind) an jeweils 15 Patienten untersucht. Dies scheint die einzige Studie zu sein, in der für die Behandlung von rheumatischen Beschwerden wichtige objektive Parameter (siehe Pharmainfo 2,3) wie Druckschmerz bei konstantem Druck und Schmerz bei maximaler Extension bestimmt wurden. Die vorliegende Studie hat aber einen entscheidenden Fehler. Die Ausgangslage der Patienten vor der Behandlung war offensichtlich nicht gleich, da in der Placebogruppe mehr Patienten mit starkem Schmerz und mit bereits geringerer Faustschlußkraft vorlagen. Ein Problem, das bei Randomisierung von relativ kleinen Gruppen immer wieder auftreten kann. So stieg zwar unter Phytodolor die Faustschlußkraft von 91 auf 113 kg, in der Placebogruppe mit offensichtlich kränkeren Patienten vom niedrigeren Wert 72 auf 87 kg. Bei den Schmerzen war es ähnlich: in der Phytodolorgruppe ist ein Abfall von 5,7 auf 1,3 in der Placebogruppe von 6,3 auf 2,6. Solche Daten erlauben keine zwingenden Schlüsse. Auffällig ist auch die kurze Testung der Substanzen über Wochen, die über eine chronische Rheumatherpie (Monate) nichts aussagt. Diese gerade diskutierten und noch einige andere noch weniger verläßliche Studien sind nicht ausreichend, um eine Phytodolorwirkung zu belegen. Wir haben bewußt den etwas mühsamen Weg gewählt, die wichtigsten von der Firma vorgelegten Studien zu diskutieren, um unsere Schlußfolgerungen nachvollziehbar zu machen. Phytodolor ist vom pharmakologischen Standpunkt weder chemisch noch bezüglich der Wirkstoffe ausreichend definiert, die klinischen Studien reichen offensichtlich nicht aus, um eine antirheumatische Wirkung dieser Substanz zu belegen. Es erscheint überraschend, daß die Registrierungsbehörde aufgrund der oben diskutierten (fast ausschließlich unveröffentlichten) Befunde dieses Präparat zugelassen hat.
P.b.b. Erscheinungsort Verlagspostamt 1010 Wien
Mittwoch, 13. November 1996
Pharmainformation
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.



