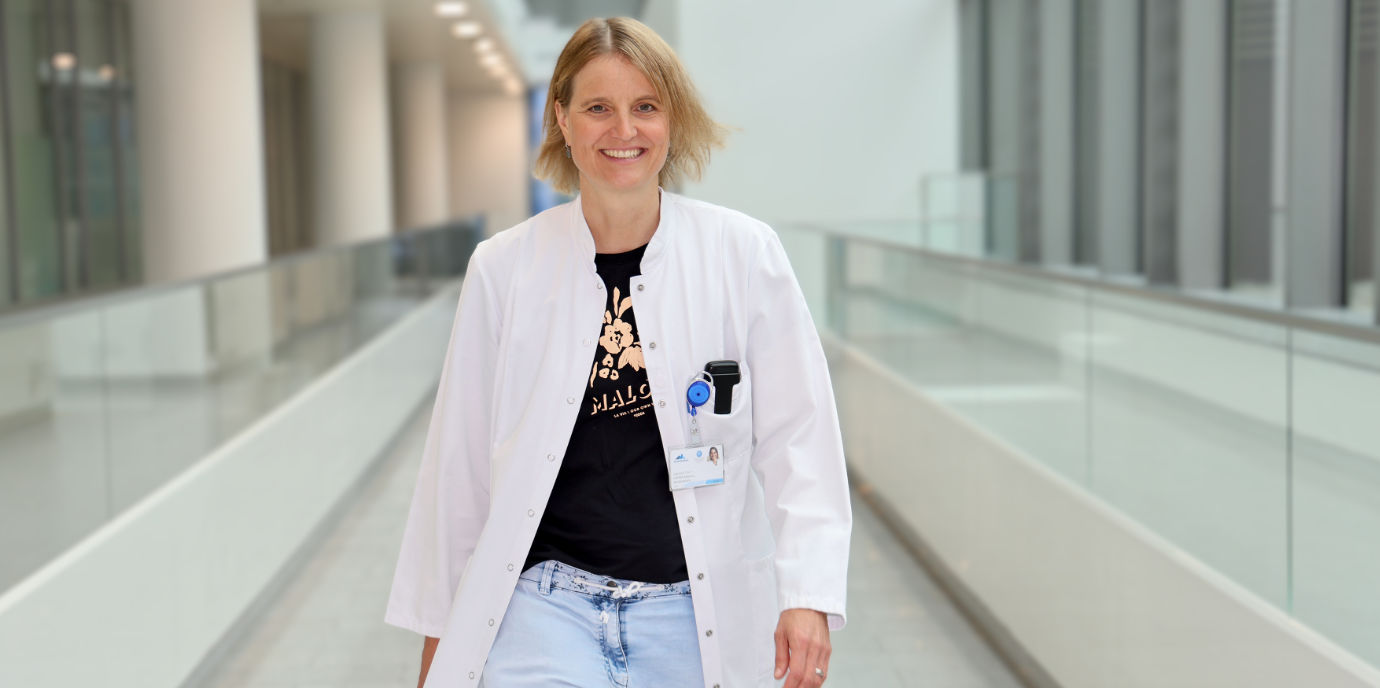Psychosomatische Beschwerden haben eine biologische Basis
Katharina Hüfner ist Neurologin und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin. Sie hat sich in der Alpinpsychiatrie einen Namen gemacht, z.B. mit Untersuchungen zu Suchtaspekten beim Bergsteigen und psychotischen Symptomen in der Höhe. Seit einem Jahr leitet sie die Univ.-Klinik fürPsychiatrie II (Psychosomatische Medizin) in Innsbruck. Zum World Mental Health Day spricht sie über die großen Missverständnisse der Psychosomatik und erklärt, wie Körper und Psyche zusammenhängen.
Das Wort „psychosomatisch“ wird im Alltag oft verwendet. Was bedeutet es wirklich?
Katharina Hüfner: Neben den biochemischen Vorgängen in einzelnen Organen betrifft Krankheit immer den ganzen Menschen. Deshalb muss man aus der Perspektive der psychosomatischen Medizin stets den gesamten Menschen behandeln – nicht ein Organ oder eine einzelne Funktionsstörung. Eine körperliche Erkrankung kann psychisch belasten und auch immunologische Veränderungen hervorrufen, die Angst oder depressive Symptome begünstigen. Umgekehrt kann psychischer Stress körperliche Symptome erzeugen oder verstärken. In unserer Umgangssprache gibt es viele Redewendungen, die auf die Psychosomatik hinweisen: Es bleibt einem die Luft weg, etwas bereitet Kopfzerbrechen, oder zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Diese Redewendungen zeigen, dass der Zusammenhang von Körper und Psyche seit jeher und auch in vielen Kulturen bekannt ist.
Sie haben immunologische Veränderungen erwähnt. Was genau ist Psychoneuroimmunologie?
Das kennt wahrscheinlich jede:r: Wer mit einer Verkühlung aufwacht, ist auch psychisch nicht fit. Bei einem akuten Infekt fühlt man sich niedergeschlagen und hat weniger Lust, andere zu treffen. Dieses Phänomen nennt man Sickness Behaviour. Evolutionär dient der Rückzug dazu, Erholung zu ermöglichen. Wenn jedoch ein langanhaltender, chronischer Immunprozess vorliegt, etwa bei rheumatoider Arthritis, können sich depressive Symptome langfristig zeigen und es kann eine depressive Erkrankung entstehen. Allerdings hat eine Depression fast nie nur eine einzige Ursache: Immundysregulation und Veränderungen in der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (auch: Cortisol-Achse) sind wichtige biologischen Faktoren. Psychische Faktoren, wie etwa hohe Anforderungen in der Arbeit, und soziale Faktoren, wie z.B. Einsamkeit, kommen ebenso dazu. Auch sie können zu Immunveränderungen führen. Die Beschäftigung mit diesen Zusammenhängen nennt man Psychoneuroimmunologie.
Warum fühlen sich manche Patient:innen mit ihren Beschwerden nicht ernstgenommen, wenn von Psychosomatik die Rede ist?
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass manchmal davon gesprochen wird, dass etwas „nur“ psychisch sei. Oder auch, wenn „psychosomatisch“ mit „eingebildet“ oder „vorgetäuscht“ gleichgesetzt wird, also als keine „richtige“ Erkrankung wahrgenommen wird. Das ist aber definitiv falsch. Psychosomatische Symptome und Erkrankungen sind real und gehen mit biologischen Veränderungen einher. Wenn ich beispielsweise aufgrund von psychischem Stress Herzklopfen und Herzrasen entwickle, bilde ich mir das nicht ein, es ist messbar. Einsamkeit kann ebenfalls immunologische und hormonelle Veränderungen hervorrufen, die sich dann in körperlichen Symptomen niederschlagen. Der Nachweis biologischer und physiologischer Marker bei psychosomatischen Beschwerden ist der Beweis dafür, dass diese Beschwerden echt sind. Trotzdem spielen neben den biologischen Faktoren eben auch psychische und soziale Aspekte eine wichtige Rolle bei diesen Beschwerden. Sie interagieren alle bei der Krankheitsentstehung. Aktuell wird besonders viel daran geforscht, wie traumatische Erfahrungen in der Kindheit das Immunsystem und das Hormonsystem verändern und so körperliche und psychische Erkrankungen begünstigen können.
Wie wird eine psychosomatische Diagnose gestellt?
Manchmal ist der Zusammenhang offensichtlich, z.B. nach einem akuten psychischen Trauma mit anschließenden dissoziativen („nicht-epileptischen“) Anfällen. Viel häufiger wirken jedoch mehrere Faktoren in unterschiedlichem Ausmaß zusammen: Das reicht von genetischen Risikofaktoren und epigenetischen Veränderungen über körperliche Erkrankungen, psychischen Stress, kulturelle Prägungen bis hin zu Vorerfahrungen der Person mit Erkrankungen und dem Gesundheitssystem. Ausführliche und genaue Patient:innen-Gespräche sind notwendig, um diese Zusammenhänge zu beleuchten. Im Vergütungssystem wird das zu wenig berücksichtigt.
Sie haben vor rund einem Jahr die Klinikleitung übernommen. Vorher haben Sie viel über Alpinpsychiatrie geforscht. Bleibt dafür noch Zeit?
Auf jeden Fall, ich mache das ja nicht alleine, sondern gemeinsam mit einem super Team. Sport, Hypoxie (Sauerstoffmangelversorgung des Gehirns, Anm.), alpine Umgebung und psychische Gesundheit werden weiter ein Schwerpunkt unserer Klinik sein. Wir haben in Innsbruck auf diesem Gebiet Pionierarbeit geleistet und uns einiges an Expertise aufgebaut. Aktuell arbeiten wir u. a. zu epigenetischen Veränderungen beim therapeutischen Klettern mit Angstpatient:innen, und wir prüfen im „Exercise is Medicine“-Projekt, wie Bergsport bei Personen mit Depressionen therapeutisch genutzt werden kann. Ein weiteres Thema ist die Wirkung von Hypoxie: Moderate Hypoxie (bis zu einem Äquivalent von 3000 m) kann möglicherweise neurobiologisch günstig wirken, starke Hypoxie ist schädlich. Epidemiologische Daten zeigen geringere Raten psychischer Erkrankungen bei Menschen, die in mittleren Höhenlagen leben.
Welche Behandlungsstrukturen bietet Ihre Klinik an?
Die Psychiatrie II ist eine Referenzeinrichtung für Psychosomatische Medizin in Tirol. Im ambulanten Bereich sind wir auf die umfassende Diagnostik psychosomatischer Beschwerden spezialisiert. Im Konsiliar-Liason-Dienst arbeiten wir eng mit den Teams in den anderen Kliniken zusammen, um Patient:innen mit körperlichen und psychischen Beschwerden bestmöglich zu betreuen. Wir bieten tagesklinische Behandlungsplätze sowohl im Erwachsenenbereich als auch im Adoleszenzbereich (16 bis 24 Jahre; gemeinsam mit den Kolleg:innen der Kinder- und Jugendpsychiatrie). Stationäre Aufenthalte an unserer Station für Psychosomatische Medizin finden nach einem ambulanten Vorgespräch statt, in dem das Therapieziel vorab mit den Patient:innen gemeinsam definiert wird.
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es dort?
Wir bieten multimodale Therapien an. Das bedeutet, dass nach einer klaren Diagnose zu Beginn ein individuelles Therapieangebot zusammengestellt wird. Dieses besteht aus Bausteinen, wie Psychotherapie, Sport und Bewegung, Ergotherapie, Kochgruppe, Entspannungstraining, Berufsplanung mit der Sozialarbeit, Biofeedback und ärztlichen Visiten. Wir nutzen auch moderne Therapieverfahren, z.B. mittels Virtual Reality und wir monitorisieren den Therapieverlauf anhand digitaler Selbstbeurteilungs-Tools. Besonders bei jungen Erwachsenen fällt uns häufig die „Knowledge-Action-Gap“ auf: Sie sind super informiert, wissen, was gut für sie wäre und was zu tun wäre, setzen es aber schwer um. Deshalb legen wir Wert auf praktische Umsetzung und Übung: Klettertherapie, statt über Bewegung sprechen; in einer Gruppentherapie echte Konflikte untereinander lösen, statt theoretisch über Kommunikation zu sprechen.
Zur Person Katharina Hüfner
Das Gespräch führte Theresa Mair.
(Innsbruck, 02.10.2025, Foto: MUI/D. Bullock)