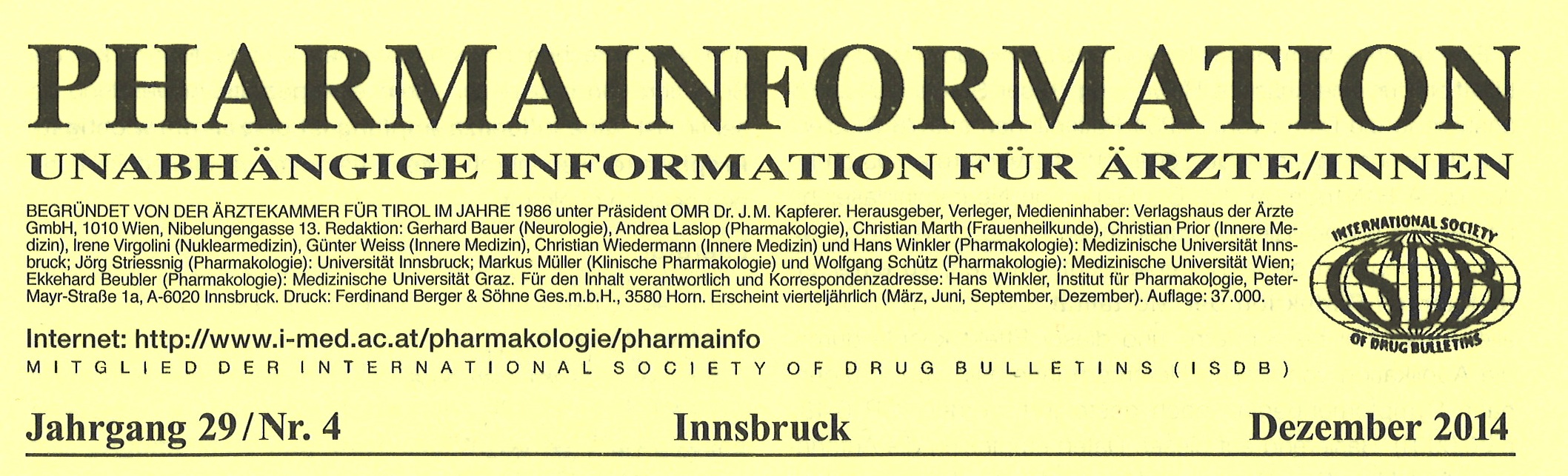
Inhalt
- Oseltamivir (Tamiflu) und Zanamvir (Relenza)
- Agomelatin (Valdoxan)
- Pulmonal-arterielle Hypertension
- Vitamin D Kontroverse
- Medikamente bei Gicht: Pegluticase (Krystexxa)
- Medikamente nach Herzinfarkt
Wie gut wirken Neuraminidase-Hemmer (Oseltamivir: Tamiflu und Zanamivir: Relenza) bei Influenza?
Wir haben diese Substanzen schon einmal besprochen (Pharmainfo XIX/4/2004; XV/4/2000). Wir konnten damals feststellen, dass eine frühzeitige Einnahme zu einer Reduktion der Beschwerdedauer und anderer Symptome um ca. 1 Tag führt, eine Reduktion von Sekundärkomplikationen und Mortalität aber noch nicht geklärt ist.
Diese Substanzen blockieren die virale Neuraminidase, wodurch die Viren sich von der Oberfläche infizierter Zellen nicht mehr ablösen können, was zur Hemmung der Virusausbreitung führt. Da die Neuraminidase nur bei Influenzaviren vorkommt, sind Neuraminidasehemmer nur gegenüber diesen Viren, nicht aber gegenüber viralen Erregern von grippalen Infekten (wie Rhinoviren, Coronaviren, Adenoviren) wirksam.
In den letzten Jahren kam es zu einer intensiven Diskussion, vor allem im British Medical Journal, wie verlässlich die Daten zur Wirkung von Neuraminidasehemmern (1) bei Influenza seien. Dies war unter anderem dadurch bedingt, dass der Versuch von Cochrane-AutorInnen, zu den Studien auch unpublizierte Daten von den Firmen zu erhalten, zuerst scheiterte und erst nach längerem Bemühen (vor allem des Brit Med J) zum Erfolg führte. Diese Cochrane-Analyse liegt nun vor (zwei Studien für Oseltamivir und eine für Zanamivir: 2).
Für Oseltamivir fasste eine Metaanalyse (3) insgesamt 83 klinische Studien zusammen. Die Einnahme von Oseltamivir führte im Vergleich zu keiner Therapie zu einer mittleren Reduktion der Symptomendauer um 16,8 Stunden bei Erwachsenen und um 29 Stunden bei ansonsten gesunden Kindern, während bei Kindern mit Asthma keine signifikante Verkürzung der Krankheitsdauer beobachtet werden konnte (3). Auch hier konnte durch die Verwendung dieses Neuraminidaseinhibitors keine Reduktion der Häufigkeit von Komplikationen wie Otitis media oder Krankenhausaufnahmen nachgewiesen werden (3). Für Pneumonien wurde für „nicht verifizierte“ Pneumonien zwar eine Reduktion gesehen, aber nicht für radiologisch diagnostizierte (3).
Für Zanamivir ergab eine Analyse von 54 Studien bei Erwachsenen analoge Resultate (4). Letztlich hat die Cochrane-Analyse trotz nun vollständiger Daten keine neuen Erkenntnisse gebracht, nach wie vor verbleibt trotz zahlreicher randomisierter Studien die Unsicherheit, inwieweit Komplikationen verhindert werden. Leider hat diese Analyse keine Daten bezüglich Therapiebeginn und Wirkung analysiert (2).
Eine früher publizierte Zusammenfassung von klinischen Studien mit Neuraminidasehemmern zeigte nämlich, dass für die Effektivität der Behandlung der Zeitfaktor eine wesentliche Rolle spielt. Werden Neuraminidasehemmer innerhalb von 12 Stunden nach Auftreten von Symptomen eingesetzt, dann reduziert sich die Krankheitsdauer um 3,1 – 4,1 Tage, während bei einer Einnahme nach 36 Stunden die Reduktion der Krankheitsdauer ca. einen Tag oder weniger beträgt (5). Könnte es sein, dass eine sehr frühe Gabe auch Komplikationen wie Pneumonie reduziert (siehe auch unten für Mortalität)?
Auch eine Erhöhung der Dosis führt zu keiner Verbesserung des klinischen Ergebnisses: Eine in Südostasien durchgeführte doppel-blind randomisierte Studie verglich die Effektivität der Standarddosis bei Erwachsenen und Kindern mit jener der doppelten Dosis. Es zeigten sich keine Unterschiede hinsichtlich der Influenza PCR-Negativität nach fünf Tagen Behandlung, der Mortalität (7,3% bei doppelter Dosis vs. 5,6% bei einfacher Dosis) oder der Effektivität bei Vergleich der verschiedenen Influenza-Virussubtypen (6). Das führt zur entscheidenden Frage, inwieweit durch Einsatz von Neuraminidaseinhibitoren die influenza-assoziierte Mortalität reduziert werden kann? Zur Beantwortung dieser Frage stehen primär nur Observationsstudien zur Verfügung. Eine systemische Analyse von solchen Studien fand heraus, dass Neuraminidasehemmer die influenza-assoziierte Mortalität bei Hochrisikogruppen deutlich reduzieren können (OR 0,23; 95% Konfidenz-Intervall 0,13-0,43), vor allem wenn diese PatientInnen intensivmedizinischer Maßnahmen bedürfen (7). Diese Metaanalyse wurde aber andernorts kritisiert, da viele der inkludierten Studien von niedriger Qualität waren und ein Bias der AutorInnen nicht ausgeschlossen werden konnte (8). Wie sehr ein Bias der AutorInnen ein Problem darstellt, zeigt eine rezente Studie zu Reviews über Neuraminidasehemmer (9) mit folgendem Resultat: 7 von 8 Studien (88%) mit einem vorhandenen finanziellen „conflict of interest“ der AutorInnen waren „favorable“, aber nur 5 von 29 Studien (17%) mit keinem. Die AutorInnen dieser Analyse fassten ihre Ergebnisse wie folgt zusammen: „Reviewers with financial conflicts of interest may be more likely to present evidence about neuraminidase inhibitors in a favorable manner and recommend the use of these drugs than reviewers without financial conflicts of interest.” (9). Eine Evaluierung von bis 2012 publizierten Observationsstudien, unter Ausschluss solcher mit unklaren statistischen Methoden oder potentiellem oder nachgewiesenem Bias, führte letztendlich zum Einschluss von nur drei Studien in eine Analyse hinsichtlich der Effekte von Oseltamivir auf Mortalität. Dabei ergab sich eine signifikante Reduktion der Mortalität durch die Verwendung von Oseltamivir, allerdings umfassen zwei dieser Studien ausschließlich PatientInnen mit Influenza A H5/N1 (“Vogelgrippe“: 8), weshalb daraus nicht ersichtlich ist, wie groß der Effekt auf die Reduktion der Mortalität bei saisonaler Influenza ist.
Eine rezente, vom Hersteller von Oseltamivir unterstützte Publikation (für eine kritische Bewertung dieser Studie siehe: 10) analysierte die Daten von 29.234 PatientInnen aus 78 Studien aus der Influenzapandemie 2009/2010 hervorgerufen durch Influenza A H1N1pdm09 (11). Die Gabe von Neuraminidaseinhibitoren bei hospitalisierten PatientInnen führte im Vergleich zu PatientInnen, die diese Therapie nicht erhielten, zu einer signifikanten Reduktion der Mortalität (OR 0,81; p=0,0024: allerdings nicht bei Kindern), und dieser Effekt konnte durch die Applikation von diesen Hemmern innerhalb von 2 Tagen nach Symptomenbeginn noch gesteigert werden (OR 0,48; p<0,0001). Basierend auf diesen Daten empfehlen die AutorInnen die frühzeitige Gabe von Neuraminidasehemmern bei hospitalisierungspflichtigen PatientInnen mit Influenza (11).
Ein weiteres Rational für die Verwendung von Neuraminidaseinhibitoren ist die Unterbrechung der Infektionskette, das heißt die Verhinderung der weiteren Übertragung der Infektion. Eine Untersuchung mit Oseltamivir zeigte, dass eine effektive Reduktion von Sekundärinfektionen (v.a. bei sog. Haushaltskontakten) um mehr als 50% im Vergleich zu Placebo erreicht werden kann, wenn der Neuraminidasehemmer innerhalb von 24 Stunden nach dem ersten Auftreten von Symptomen eingenommen wird (12). Danach konnte kein signifikanter Effekt mehr erzielt werden.
Neuraminidasehemmer sind auch für Prävention einer Influenza zugelassen, insbesondere wenn die betreffenden PatientInnen nicht geimpft werden konnten und ein erhöhtes Risiko für Komplikationen einer Influenza haben. Die prophylaktische Einnahme von Zanamivir reduzierte die Wahrscheinlichkeit für eine Influenza von 3,26% auf 1,27%, was bedeutet, dass 50 Personen prophylaktisch für 10 – 14 Tage behandelt werden müssen, um eine Infektion zu verhindern (4). Ähnliche Daten liegen für Oseltamivir vor, wo die prophylaktische Gabe die Infektionswahrscheinlichkeit während einer Influenzaepidemie um 55% reduzierte (3). Vor allem in Hinblick auf die Möglichkeit der Selektion von resistenten Viren, der therapie-assoziierten Nebenwirkungen und Kosten und der nur relativ geringen präventiven Effektivität sollten Neuraminidasehemmer im Regelfall (Ausnahmen z.B. immunsupprimierte PatientInnen) nicht für die Prävention von Influenzainfektionen eingesetzt werden. Hier steht nach wie vor die jährliche Impfung im Vordergrund, wenngleich auch diese nur einen teilweisen Schutz bietet (30-70% Protektionswahrscheinlichkeit) und in Hinblick auf Applikationsform, Virusspeziesabdeckung und Effektivität nach wie vor verbesserungswürdig ist.
An Nebenwirkungen treten bei Oseltamivir Übelkeit (NNH: 28) und Erbrechen (NNH: 22) auf (2,3), und ein Zusammenhang mit psychiatrischen Symptomen (wie Depression und Halluzinationen) erscheint möglich (13). Für die Zanamivir-Inhalation sind bronchospastische Effekte beschrieben (2,4).
Zusammenfassung: Neuraminidasehemmer können die Erkrankungsdauer einer Influenzainfektion reduzieren, wobei ein klinisch relevanter Effekt nur bei Einnahme innerhalb von 24 Stunden nach Auftreten von Influenza-assoziierten Symptomen nachgewiesen werden kann. Dies gilt auch für die Verhinderung der weiteren Übertragung auf andere Personen. Die vorliegenden Daten belegen aber nicht eine Reduktion von Komplikationen wie Pneumonie. Bei hospitalisierungspflichtigen PatientInnen mit Influenza, wo die Therapie mit Neuraminidasehemmern eine Mortalitätsreduktion bewirken könnte, ist auch noch eine spätere Gabe zu akzeptieren.
Neuraminidasehemmer sollten primär nicht für die Prophylaxe von Influenzainfektionen verwendet werden und haben keinen Effekt bei anderen Virusinfektionen, weshalb - wie bei allen anderen Antiinfektiva - auch in Hinblick auf Nebenwirkungen (wie Erbrechen, Bronchospasmen) und der Möglichkeit der Selektion von resistenten Viren eine gezielte Anwendung essentiell ist. Eine Influenza-Impfung ist derzeit die wichtigste Prophylaxe, wenngleich deren Effektivität bei älteren PatientInnen deutlich abnimmt.
Literatur:
(1) BMJ 348,g2675,2014
(2) Cochrane Database Syst Rev. Apr 10,4:CD008965,2014
(3) BMJ 348,g2545,2014
(4) BMJ 348,g2547,2014
(5) N Engl J Med 353,1363,2005
(6) BMJ 346,f3039,2013
(7) Ann Intern Med 156,512,2012
(8) BMJ 348,g2371,2014
(9) Ann Int Med 161,513,2014
(10) BMJ 348,g2228,2014
(11) Lancet Respir Med 2,395,2014
(12) Clin Infect Dis 50,707,2010
(13) BMJ 347,f465,2013
Update Agomelatin (Valdoxan)
Für dieses schon länger zugelassene Antidepressivum hat das Pharmacovigilance Risk Assessment Committee in London (PRAC) die Aufnahme einer Kontraindikation für PatientInnen über 75 Jahren empfohlen (EMA 12/09/2014) und zwar wegen eines erhöhten Risikos von Lebertoxizität und nicht belegter Wirkung bei diesen PatientInnen. Das Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP; siehe EMA 26/09/2014) hat hingegen eine Warnung (siehe Fachinformation 4.2) i.e. „sollte bei diesen Patienten nicht angewendet werden“ zusammen mit neuerlichen Hinweisen auf die Lebertoxizität als ausreichend betrachtet. Wir haben kürzlich (siehe Pharmainfo XXIX/2/2014) darauf hingewiesen, dass solche Divergenzen zwischen den Entscheidungsgremien bei der EMA dazu dienen Unsicherheit zu kreieren. Auf jeden Fall ist die Frage berechtigt, kann ein Präparat bei PatientInnen über 75 Jahren negativ indiziert sein und bei z.B. 65jährigen wieder als indiziert angesehen werden. Eine kritische Analyse der heutigen Datenlage erscheint daher angebracht.
In der Pharmainfo XXIV/4/2009 haben wir dieses Medikament besprochen und festgestellt, dass schon die Zulassung (negatives Minderheitsvotum) umstritten war und zwar wegen inkonsistenter (auch negative Studien) und gegenüber Vergleichspräparaten schwächerer Wirkung und der damals schon bekannten Lebertoxizität. Inzwischen ist die Diskussion weitergegangen, positiven Evaluierungen (1,2) stehen kritische Analysen gegenüber. So wurde schon 2011 (3) festgestellt, dass zwar publizierte Studien positive Daten für Agomelatin berichten, Studien mit negativen Daten aber nicht publiziert wurden. Dieser „publication bias“ wird auch in zwei rezenten firmenunabhängigen und kritischen Metaanalysen thematisiert (4,5; siehe dazu auch Editorial: 6). Wir konzentrieren uns hier auf Studien, die Agomelatin mit Placebo verglichen haben, da bei mangelnder Wirkung gegenüber einem Placebo ein Vergleich mit anderen Antidepressiva (siehe Cochrane Review: 7) nur eine limitierte Relevanz hat. In der einen Metaanalyse (4) wurden 5 publizierte Studien bewertet, die alle gemessen mit der Hamilton Depressionsskala signifikant positive Ergebnisse berichteten, von 7 unpublizierten Studien waren aber 5 negativ (in einer war sogar das Placebo besser), eine, die inzwischen publiziert wurde, war positiv, und eine war auffällig besser als die anderen Studien (RR: 2,07 vgl. mit 0,89 bis 1,54). Möglicherweise hat man auf die Publikation dieser Studie verzichten müssen, da Resultate, die so aus dem Rahmen fallen, wenig verlässlich erscheinen – wie gesagt möglicherweise, da ja eine kritische Bewertung nur nach Publikation möglich ist.
Wenn alle Studien zusammen bewertet werden, ergibt sich ein statistisch signifikanter Effekt in Kurzzeitstudien (4,5), in Langzeitstudien (n=4) war aber kein signifikanter Effekt auf die Rückfallraten zu erhalten (4). Bei großen Fallzahlen, wie dies bei Metaanalysen der Fall ist, können sehr kleine Unterschiede (z.B. ein Unterschied in der Hamilton 50-Punkte Skala von 2,00 zwischen Placebo und Verum: 2) statistisch signifikant werden; dies impliziert aber nicht automatisch einen klinisch relevanten Effekt. So ist die Conclusion in einer Analyse (5): „a clinically important difference between agomelatine and placebo is unlikely”. Für die zweite Metaanalyse (4) stellt ein Editorial (6) fest: “Agomelatine may work slightly better than a placebo, but the effect size of 0.26 is well below the threshold of clinical relevance of 0.50 adopted”. Der “effect size” wird berechnet aus der Differenz zwischen den Mittelwerten Verum versus Placebo, dividiert durch die gepoolte Streuung, und ist daher höher wenn das Verum deutlich besser wirkt, wenn die Resultate aber stark streuen niedriger. Ein effect size of 0,8 zeigt auf eine gute klinische Wirkung, 0,5 ist im Mittel, 0,2 gering (4).
Bezüglich Nebenwirkungen wird für Agomelatin vor allem eine geringe Beeinträchtigung von Sexualfunktionen propagiert. Hierzu wurden vor allem 2 Doppelblindstudien zitiert (8). In einer Arbeit (8a) wurde Agomelatin mit Paroxetin (Generika, Seroxat) auf die Beeinflussung sexueller Aktivitäten über 8 Wochen an gesunden ProbandInnen verglichen. Paroxetin zeigte gegenüber Placebo signifikant negative Effekte, während Agomelatin sich nur wenig von Placebo unterschied. Allerdings ist Paroxetin ein SSRI, das auf sexuelle Parameter negativer als andere Antidepressiva wirkt (8,9) und daher keine ideale Vergleichssubstanz darstellt. Relevanter ist daher eine Studie (10), die Agomelatin mit Venlafaxin (Generika, Efectin) verglich, das als SNRI eine geringere Wirkung auf Sexualfunktionen hat (8). Die sexuelle Aktivität wurde mit einer „11-item clinician administered sex FX scale“ untersucht. Wenn man die Prozentsätze von PatientInnen, die im Verlauf der Therapie sich auf dieser Skala zumindest um einen Punkt verschlechterten, betrachtet, war Agomelatin gegenüber Venlafaxin besser zu bewerten. Auf einer Skala mit einer Punktezahl von 44 (11 items mit 0 – 4 Punkten) sind ein oder einige Punkte von fraglicher klinischer Relevanz, daher sind Ergebnisse für die tatsächlichen Gesamtpunkte (und nicht kleine Verschiebungen) entscheidend. Hier waren bei Männern und Frauen die Werte für alle Domains (arousal, orgasm and desire) praktisch ident, mit einer Ausnahme, i.e. beim Orgasmus für Frauen war ein Unterschied zwischen den beiden Substanzen mit 1,9 Punkten statistisch signifikant. Diese Resultate belegen daher keineswegs einen klinisch relevanten Unterschied, sondern sprechen für eine vergleichbare Interferenz von Agomelatin und Venlafaxin im Sexualbereich.
Agomelatin dürfte gegenüber SSRI, zumindest gegenüber Paroxetin, weniger negativ auf Sexualfunktionen wirken, gegenüber dem SNRI Venlafaxin scheint dies nicht der Fall zu sein. Wenn im Rahmen einer Therapie mit SSRI Probleme im Sexualbereich auftreten, ist ein Wechsel auf ein anderes Antidepressivum überlegenswert, es bieten sich hierzu z.B. Substanzen mit gut belegter Wirkung aus anderen Gruppen an, z.B. Venlafaxin oder Bupropion (Carmubine, Wellbutrin), für die eine geringere Interferenz im Sexualbereich belegt ist (9). Da für Agomelatin die antidepressive Wirkung umstritten ist, kann eine geringere Nebenwirkung kein Argument für einen Wechsel zu diesem Präparat sein.
Die Lebertoxizität von Agomelatin war schon bei Zulassung bekannt, in einer Studie (11) wurde eine Erhöhung der Leberwerte um das 3fache bei bis zu 4,5% der PatientInnen beobachtet, Agomelatin dürfte verglichen mit anderen Antidepressiva ein höheres Lebertoxizitätsrisiko haben (12), in Deutschland (BfArM) war bei 10% der gemeldeten Leberbeteiligungen eine toxische Hepatitis gegeben (13). Eine regelmäßige Kontrolle der Leberwerte (am Beginn und nach 3, 6, 12 und 24 Wochen und dann, wenn klinisch indiziert) ist daher vorgeschrieben (siehe Fachinformation).
Zusammengefasst:
Im Jahre 2009 (Pharmainfo XXIV/4) haben wir festgestellt, dass aufgrund unklarer Datenlage für Agomelatin der Arzt/die Ärztin die Möglichkeit hat, ein solches Präparat erst zu verschreiben, wenn weitere Resultate ein positives Nutzen/Risiko-Verhältnis belegen sollten. Die inzwischen vorliegenden Daten zur umstrittenen Wirkung, zur Lebertoxizität und die Empfehlung, dieses Präparat bei über 75jährigen PatientInnen nicht zu geben, zeigen, dass wir heute noch weniger als damals von einem klar positiven Nutzen/Risiko-Verhältnis sprechen können.
Literatur:
(1) Int Clin Psychopharm 28,12,2013
(2) J Neuropsych Clin Neurosci 24,290,2012
(3) J Psychosocnursing 49,11,2011
(4) BMJ 348,g1888,2014
(5) Br J Psych 203,179,2013
(6) BMJ 348,g2157,2014
(7) Cochrane Library, Issue 12,CD008851,2013
(8) Hum Psychopharm 26,537,2011
(8a) J Psychopharm 24,111,2010
(9) Ann Int Med 155,772,2011
(10) J Clin Psychopharm 28,329,2008
(11) J Clin Psychopharm 30,135,2010
(12) J Clin Psychopharm 34,327,2014
(13) Pharmakopsych 46,214,2013
Medikamentöse Therapie der pulmonal-arteriellen Hypertension
Pulmonale Hypertension ist definiert als eine Erhöhung des invasiv gemessenen mittleren pulmonal-arteriellen Drucks auf >25 mm Hg in Ruhe. Die Klassifikation des weiten Erkrankungsspektrums „Pulmonale Hypertension“ wird in regelmäßigen Abständen überarbeitet, zuletzt im Rahmen eines Weltsymposiums in Nizza 2013. Die Systematik der pulmonalen Hypertension umfasst demnach die pulmonal-arterielle Hypertension (PAH; Pathologie primär der Lungenarterien; Gruppe 1), pulmonale Hypertension in Assoziation mit Linksherz- (Gruppe 2) oder Lungenerkrankungen (Gruppe 3), pulmonale Hypertension als Thromboemboliefolge (Gruppe 4) und andere, z.T. ungeklärte Formen (Gruppe 5). Die pulmonal-arterielle Hypertension (Gruppe 1) ist eine seltene Erkrankung, mit einer Prävalenz von 5,9 bis 48 / 1 Million (1,2). Dies trifft auch für die anderen Formen zu, mit Ausnahme des Lungenhochdrucks durch Linksherzerkrankung (Gruppe 2) mit über 2000 Fällen / 1 Million (2).
Allgemeine therapeutische Maßnahmen
Als allgemeine therapeutische Maßnahmen werden eine orale Antikoagulation mittels Vitamin-K-Antagonisten, Diuretika zur Vorlastsenkung und die Anwendung einer Langzeitsauerstofftherapie nach den üblichen Kriterien empfohlen. Frauen im gebärfähigen Alter müssen wegen zu erwartender Komplikationen im Falle einer Schwangerschaft eine verlässliche Form der Kontrazeption anwenden.
Spezifische medikamentöse Therapieformen
Diese kommen bei der PAH (Gruppe 1 der Nizza-Klassifikation) zum Einsatz. Dabei handelt es sich um typischerweise progrediente Erkrankungen des pulmonal-arteriellen Gefäßbettes. Sie sind gekennzeichnet durch Umbauprozesse der Gefäßwände, in-situ-Thrombosen und pulmonale Widerstandserhöhung, die zu Rechtsherzbelastung und zum Tod durch Rechtsherzversagen führt. Die Erkrankung kann idiopathisch / familiär gehäuft auftreten, toxisch bedingt sein (Appetitzügler: z.B. Fenfluramin; Nahrungsmittelvergiftung durch Speiseöl in Spanien) oder mit anderen Erkrankungsbildern (z. B. Kollagenose, HIV-Infektion, portale Hypertension) assoziiert sein.
Die bei der PAH eingesetzten Substanzen sollen einerseits zu einer maximalen Vasodilatation des pulmonal-arteriellen Gefäßbetts führen und andererseits durch ihre antiproliferative Wirkung den Umbauprozessen der Gefäße („remodelling“) entgegenwirken. Bei pulmonaler Hypertension im Kontext von Herz- oder Lungenerkrankungen (Gruppen 2 und 3) sowie in der bezüglich ihrer Pathogenese sehr heterogenen Gruppe 5 wurden bisher entweder keine eindeutig günstigen Effekte beschrieben oder sogar, wie im Falle der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (3) und von Linksherzerkrankungen (4), negative Effekte beobachtet. Der Endothelin-Antagonist Ambrisentan (siehe unten) ist bei idiopathischer Lungenfibrose kontraindiziert (5). Bei inoperabler oder nach Operation persistierender chronisch-thromboembolischer pulmonaler Hypertension (CTEPH, Gruppe 4) ist der Wirkstoff Riociguat (siehe unten) zugelassen.
Klinische Endpunkte
Der am häufigsten verwendete Parameter ist die 6-Minuten-Gehstrecke (6MWD: six-minute walk distance), wobei sich die Verbesserungen durch die Therapie – bei einem Ausgangswert von +300 m – im Rahmen von 30 bis 50 m bewegen (6). Welche Verbesserungen klinisch relevant sind, wird debattiert – dies soll aber für einen Anstieg von 30 – 40 m der Fall sein (6-8).
Für den/die Patienten/in subjektiv besonders relevant sind Parameter wie Dyspnoe-Index, Verbesserung des Krankheitsbildes (WHO functional class I – IV), Lebensqualität, „time to clinical worsening“ (z.B. akute Hospitalisierung) und dann insbesondere, wenn man die reduzierte Lebenserwartung bedenkt, die Mortalität. Auch Veränderungen der hämodynamischen Messwerte (Pulmonalisdruck, Lungengefäßwiderstand, Cardiac Index) sind für die Verlaufsbeurteilung und Bewertung der Medikamentenwirkung von Bedeutung.
Wir besprechen im Folgenden die einzelnen Studien - da mit sehr vergleichbaren Resultaten - nicht im Detail, sondern geben nur die Primärparameter (z.B. Wegstrecke) an.
Medikamente
Calciumantagonisten
Vor Beginn einer spezifischen PAH-Therapie ist ein sog. Vasoreagibilitätstest mit inhalativem Stickoxid oder intravenösem Epoprostenol durchzuführen. Bis zu 10% der PatientInnen mit PAH zeigen hierbei einen signifikanten Abfall des Pulmonalisdrucks und des pulmonalen Gefäßwiderstands um >20%. Diese sollen als Ersttherapie orale Calciumantagonisten in steigender Dosierung („Dosistitration“) erhalten (9,10). Wenn Calciumantagonisten zur Erreichung klinischer Therapieziele nicht ausreichen, kommen in weiterer Folge spezifische Vasodilatatoren zum Einsatz.
Prostanoide
Prostaglandin I2 (Prostazyklin) besitzt vasodilatatorische, antithrombotische, antiproliferative und immunomodulatorische Eigenschaften. Es wird vermutet, dass ein lokaler Mangel an Prostazyklin wesentlich zur der Pathogenese der PAH beiträgt. Für therapeutische Zwecke stehen stabile Prostazyklin-Analoga zur Verfügung. Die Verabreichung erfolgt als Dauerinfusion über eine portable Infusionspumpe intravenös (Epoprostenol: Flolan, Veletri; Treprostinil: Remodulin) oder subkutan (Treprostinil: Remodulin); auch eine inhalative Verabreichung ist möglich (Iloprost: Ventavis). Prostanoide werden bei PAH in Funktionsklasse III und IV nach der New York Heart Association (NYHA)-Klassifizierung eingesetzt.
Epoprostenol (Flolan, Veletri): In einer relativ kleinen (n=81) Studie über 12 Wochen stieg unter Therapie die 6-Minuten-Gehstrecke von 315 auf 362 m, während sie in der Kontrollgruppe von 270 auf 204 m sank (11). In der Kontrollgruppe (n=40) verstarben 8 PatientInnen, in der Verumgruppe (n=41) keine/r. Die hohe Mortalität in der Kontrollgruppe dürfte auf die Schwere der Erkrankung (Funktionsklasse III und IV) zurückzuführen sein, offensichtlich wird sie durch Epoprostenol deutlich gesenkt. Wegen der kurzen Halbwertszeit und der Temperaturempfindlichkeit von Epoprostenol ist die Verabreichung schwer praktikabel (intravenöser Dauerkatheter, häufiges Nachfüllen der Pumpe, Kühlung) und bleibt üblicherweise den PatientInnen in Funktionsklasse IV vorbehalten.
Treprostinil (Remodulin) besitzt eine längere Halbwertszeit und kann über eine Mikroinfusionspumpe subkutan verabreicht werden. Eine intravenöse oder inhalative Gabe sind ebenfalls möglich. In einer Studie über 12 Wochen (n=470; 12) verbesserte Treprostinil als subkutane Infusion die Gehstrecke um 16 m. In der Mortalität wurde, obwohl zum Großteil PatientInnen der Funktionsklassen III und IV behandelt wurden, keine Veränderung gesehen (jeweils 8 von 233 bzw. 236 PatientInnen). Bedeutsamste Nebenwirkung der subkutanen Infusion sind Schmerzen an der Infusionsstelle (85% der PatientInnen; 12).
Für inhalatives Iloprost (Ventavis)wurden nach 12 Wochen Therapie einige Verbesserungen gefunden (z.B. Anstieg der Gehstrecke um mehr als 10%), dies war aber im Vergleich zu Placebo nicht signifikant unterschiedlich (13). Positive, länger dauernde Effekte konnten weder für inhalatives (14) noch für intravenöses Iloprost (15) gefunden werden.
Phosphodiesterase-5-Hemmer und Guanylat-Zyklase-Aktivator
Phosphodiesterase-5-Hemmer vermindern den Abbau von zyklischem Guanosin-Monophosphat (cGMP), das vasodilatatorisch und proliferationshemmend wirkt.
Sildenafil (Revatio) wurde in einer Studie mit 278 PatientInnen mit PAH über 12 Wochen getestet (16). Die 6-Minuten-Gehstrecke nahm je nach Dosis um 45 bis 50 m zu. Ähnliche Daten wurden in einer Studie (n=405, 16 Wochen) für Tadalafil (Adcirca; 17) erhalten (Wegstreckenzunahme mit bis zu 33 m etwas geringer).
Riociguat (Adempas) stimuliert die lösliche Guanylat-Zyklase und dadurch die Synthese des vasodilatatorisch wirkenden cGMP. Dieses kürzlich zugelassene Mittel wurde in einer Studie an 443 PatientInnen mit PAH untersucht (18). Nach 12 Wochen zeigte sich eine Verlängerung der 6-Minuten-Gehstrecke um 36 m. Für Mortalität wurden keine Daten publiziert. Ein Editorial (6) sieht für diese Substanz nur eine „modest activity“, dies trifft aber auch auf die anderen Substanzen zu.
Riociguat wurde auch an PatientInnen mit pulmonaler Hypertension als Thromboemboliefolge (CTEPH, Gruppe 4) mit ähnlichen Resultaten untersucht (19). Es hat daher auch eine Zulassung für diese Indikation (als einziges orales Präparat).
Als Nebenwirkungen sind für alle drei Substanzen Dyspepsie, Diarrhoe und Flushbildung beschrieben. Für Riociguat wurden Fälle von schweren Lungenblutungen beobachtet (siehe Fachinformation).
Endothelin-Rezeptor-Antagonisten
Endothelin-1 ist ein Mediator mit vasokonstriktorischer und proliferationsfördernder Wirkung auf die glatte Muskulatur der Gefäßwände. Er wirkt über Rezeptoren der Isoformen A (an glatten Muskelzellen) und B (an Endothelzellen). Derzeit sind der selektive Endothelin-A-Rezeptor-Antagonist Ambrisentan (Volibris) und die dualen Endothelin A- und B-Rezeptor-Antagonisten Bosentan (Tracleer) und Macicentan (Opsumit) zur Therapie der PAH zugelassen.
Bosentan (Tracleer) wurde in einer Studie mit 213 PatientInnen für 12 Wochen getestet (20). Die 6-Minuten-Gehstrecke nahm um 44 m zu. Leberenzymwerte stiegen bei 13% der PatientInnen an (20), ein weiterer Endothelinantagonist, Sitaxentan, wurde wegen Lebertoxizität vom Markt genommen. Für Bosentan sind monatliche Leberenzymkontrollen vorgeschrieben.
Ambrisentan (Volibris) wurde in zwei Studien (ARIES-1 und -2; 21) an 394 PatientInnen getestet. Nach 12 Wochen kam es zur Verbesserung der Wegstrecke bis zu 59 m. Es kam zu keiner Erhöhung der Leberenzymwerte. Nach Markteinführung wurden aber Anstiege der Leberenzyme und Fälle von Autoimmunhepatitis berichtet. Eine monatliche Kontrolle der Leberenzyme wird daher auch bei Ambrisentan empfohlen. Für PatientInnen mit idiopathischer Lungenfibrose ist Ambrisentan kontraindiziert (5).
Für Macicentan (Opsumit) wurde eine Studie durchgeführt (n=742; 22), die das zentrale Problem der Therapie für diese Erkrankung, nämlich die Langzeitwirkung der Medikamente und die Senkung der Mortalität, klären sollte. Für den zusammengesetzten Parameter (Verschlechterung der pulmonalen Hypertonie, zusätzliche Prostazyklintherapie, Lungentransplantation und Tod) kam es innerhalb von 3 Jahren zu einer signifikanten Verbesserung (Placebo: 46,4%, Macicentan 10 mg: 31,4%; HR 0,55; p<0,001). Das war allerdings fast ausschließlich durch das „Event“ Verschlechterung der pulmonalen Hypertonie (Abfall der Gehstrecke, Verschlechterung der Symptome und notwendige zusätzliche Therapie) bedingt (von 37,2% auf 24,4%, während die Mortalität mit 6,8% bzw. 6,6% praktisch unverändert blieb. Auch bei einem weiteren zusammengesetzten Parameter (Tod oder Hospitalisierung wegen pulmonaler Hypertonie) war die Mortalität mit 2,0 bzw. 2,1% nicht verändert. Nur bei Todesfällen, die auch bei PatientInnen nach der Doppelblindphase auftraten, war eine Senkung zu sehen, allerdings nur numerisch und nicht statistisch signifikant. Nach 6 Monaten Therapie war die 6-Minuten-Gehstrecke nur um 22 m verbessert, zu einer Verbesserung der WHO-Funktionsklasse kam es bei 13% in der Placebo- und bei 22% in der Verumgruppe (Macicentan 10 mg). Die Resultate für die Wegstrecke sind von fraglicher klinischer Relevanz, besonders enttäuschend sind aber die Daten zur Mortalität, wo es im Rahmen des verlässlichen Primärparameters zu keiner Verbesserung kam und nur bei einem Teil der Sekundärparameter zu einem allerdings nur numerischen Abfall. Möglicherweise (hierzu gibt es aber keine Daten) hat die Basistherapie bei 60% der PatientInnen mit einem Phosphodiesterase-5-Hemmer die Mortalität bereits reduziert. Wie dem auch sei, wenn es in der Publikation zu Macicentan (22) in der Zusammenfassung heißt: „Macicentan significantly reduced morbidity and mortality“, so ist dies ungenau, da nur der Gesamtparameter, aber nicht die Mortalität signifikant reduziert wurden. Diese missverständliche Formulierung könnte darauf zurückzuführen sein, dass diese firmengesponserte Studie einen „professional medical writer“ für die Manuskriptverfassung zur Verfügung stellte, die Firma führte auch alle statistischen Analysen durch.
In der Zulassungsstudie kam es im Vergleich zu Placebo zu keinem vermehrten Anstieg von Leberenzymen, trotzdem werden in Hinblick auf die Erfahrungen mit Sitaxentan und Bosentan regelmäßige Kontrollen der Leberwerte empfohlen.
Kombinationstherapie
Bei unzureichender Wirkung einer Einzelsubstanz oder bei Erreichen der höchsten tolerierten Dosis werden sequentielle Kombinationen von Prostanoiden, Endothelin-Rezeptor-Antagonisten und Phosphodiesterase-5-Inhibitoren eingesetzt (10). Mit welcher Substanzgruppe begonnen werden soll und welches Präparat als erstes zugegeben werden soll, ist nicht durch Studiendaten gesichert und bleibt der Entscheidung des/der behandelnden Arztes/Ärztin überlassen. PatientInnen in Funktionsklasse IV sollten jedenfalls ein Prostanoid erhalten.
Überlebensrate
Die Prognose der PAH hat sich im Verlauf der letzten 20 Jahre deutlich verbessert. So beträgt die Überlebensrate nach drei, fünf und sieben Jahren heute 68%, 57% und 49%, während historische Zahlen (NIH equation) nur bei 47%, 36% und 32% lagen (23).
Dies dürfte auf eine Verbesserung der Diagnosestellung und allgemeine und spezifische Maßnahmen der Therapie zurückzuführen sein. Inwieweit die hier diskutierten Medikamente dazu beitragen, ist unklar, da zum Überleben fast keine Studiendaten vorliegen. Eine größere Studie über drei Jahre für den Endothelin-Antagonisten Macicentan (22) hat gegenüber Placebo für die Senkung der Mortalität sogar keine signifikanten Resultate gebracht, allerdings erhielten 60% der PatientInnen bereits einen Phosphodiesterase-5-Hemmer.
Studien zur Mortalität, die die verschiedenen Wirkstoffe vergleichen, sind dringend notwendig, um für diesen PatientInnen-relevanten Parameter klare Aussagen machen zu können.
Zusammenfassung
Aufgrund der vorliegenden Daten sind medizinisch und ökonomisch aus den einzelnen Gruppen folgende Wirkstoffe vorzuziehen: Prostanoide: Treprostinil; Phosphodiesterase-5-Hemmer: Sildenafil, und Endothelinantagonisten: Ambrisentan.
Literatur:
(1) Am J Respir Crit Care Med 173,1023,2006
(2) Heart 98,1805,2012
(3) Eur Respir J 32,619,2008
(4) Circulation 118,2190,2008
(5) Ann Intern Med 158,641,2013
(6) N Engl J Med 369,386,2013
(7) Am J Respir Crit Care Med 186,428,2012
(8) Circulation 126,349,2012
(9) N Engl J Med 327,76,1992
(10) J Am Coll Cardiol 62,D60,2013
(11) N Engl J Med 334,296,1996
(12) Am J Respir Crit Care Med 165,800,2002
(13) N Engl J Med 347,322,2002
(14) Eur Heart J 26,1895,2005
(15) Eur Respir J 34,132,2009
(16) N Engl J Med 353,2148,2005
(17) Circulation 119,2894,2009
(18) N Engl J Med 369,330,2013
(19) N Engl J Med 369,319,2013
(20) N Engl J Med 346,896,2002
(21) Circulation 117,3010,2008
(22) N Engl J Med 369,809,2013
(23) Chest 142,448,2012
Update Vitamine - insbesondere zur Kontroverse Vitamin D
Vitamine wurden immer wieder als Wundermittel (geradezu als Panaceen) propagiert und dementsprechend von vielen Personen, die aufgrund einer „normalen“ Ernährung keinen Vitaminmangel hatten, eingenommen.
Der Nutzen der Vitamine A, B, C und E schien für die Prävention zahlreicher Erkrankungen, vor allem durch Beobachtungsstudien (z.B. Korrelation von niederen Vitaminspiegeln im Blut und Erkrankungen) belegt, diese Studien können aber keinen kausalen Zusammenhang belegen und daher sind prospektive, randomisierte Interventionsstudien mit einer Kontrollgruppe entscheidend. Tatsächlich haben dann diese Studien an Tausenden von Personen und einer jahrelangen Studiendauer keinen Nutzen bei der Prävention z.B. von kardiovaskulären und zerebralen (z.B. Abnahme der kognitiven Fähigkeiten) Erkrankungen und Krebs zeigen können und auch die Mortalität wurde nicht reduziert. Für Vitamin A und E wurden bei Supplementierung sogar negative Effekte (mehr Lungenkarzinome bei Rauchern für A und Herzinsuffizienz für E) erhalten (siehe Pharmainfo XIX/2/2004, XXII/2/2007, XXV/3/2010, XXVIII/3/2013, für A siehe auch 1).
Für Personen mit einer gesunden Ernährung ist daher die Gabe dieser Vitamine nutzlos bis schädlich. Als Hoffnungsträger für eine breitgestreute Vitamin-Substitution in der Bevölkerung verblieb Vitamin D, für das wiederum aufgrund von Beobachtungsstudien positive Effekte bei kardiovaskulären und zerebralen (wie Multiple Sklerose, Abnahme kognitiver Fähigkeiten) Erkrankungen, Diabetes, Infektionen, Krebs und Mortalität postuliert wurden (für Osteoporose und Stürze (siehe unten). Vorweggenommen sei die unbestrittene Aussage, dass Vitamin D zur Rachitisprophylaxe und zur Behandlung von schweren Mangelzuständen (Osteomalazie) indiziert ist.
Medizinhistorisch hat sich immer wieder gezeigt, dass solche Panacea-ähnlichen Wirkungen letztlich sich als unrealistisch erweisen. Aber diskutieren wir die Faktenlage für dieses Vitamin. Zum möglichen Nutzen dieses Vitamins liegen tausende Arbeiten, dutzende große Metaanalysen und sehr kontroverse Aussagen vor. Im Jahre 2014 wurden einige sehr umfassende Analysen publiziert, sodass wir versuchen können, doch einige klare Aussagen zu machen. Ein ausführlicher Review (2) analysiert 292 Beobachtungs- bzw. 172 randomisierte Interventionsstudien und 28 Metaanalysen und fand für erstere eine „moderate bis starke Assoziierung zwischen Vitamin D-Blutspiegeln und den oben genannten Erkrankungen“ (Skeletterkrankungen wie Osteoporose waren ausgenommen). In den randomisierten Studien war hingegen Vitamin D ohne positiven (auch ohne nachteiligen) Effekt. Dies galt auch für Personen, deren Blutspiegel unter 50 nmol/l (20 ng/ml) 25–Hydroxyvitamin D lag und die eine höhere Dosis als 50 µg Vitamin D erhielten. Diese Aussage ist relevant, da sie das Argument widerlegt, die negativen Ergebnisse könnten auf eine nicht ausreichende Dosis des Vitamins bzw. auf StudienteilnehmerInnen, die völlig ausreichend mit Vitamin D versorgt waren (Blutspiegel über 50 nmol/l), zurückzuführen sein.
Ein rezenter „Umbrella Review of systematic reviews“ (was ist wohl die nächste Steigerungsstufe?) von 74 Metaanalysen von Beobachtungsstudien und 87 Metaanalysen von Interventionsstudien kam zu einem analogen Ergebnis (3) und dies war auch der Fall für eine neue Metaanalyse (4).
Als Erklärung für die Diskrepanz zwischen Beobachtungs- und Interventionsstudien wird u.a. vorgeschlagen (2), dass ein niedriger Vitamin D-Spiegel im Blut eine Folge der verschiedenen Erkrankungen und nicht deren Ursache sei und dementsprechend eine Supplementierung nicht die Krankheitsfrequenz bzw. deren Symptome ändern kann.
Bezüglich Vitamin D und Mortalität fand ein ausführlicher Cochrane-Review (56 randomisierte Studien mit 95.286 Personen: 5) eine minimale Reduktion (RR 0.97, CI 0,94 – 0,99). Als eine mögliche Ursache dieser Reduktion sprechen die Autoren einen verbesserten Knochenstoffwechsel und Verbesserung der Muskelkraft und als Folge eine Verminderung von Stürzen bei alten Personen an. Dafür würde auch sprechen, dass Vitamin D, wie oben diskutiert, die Häufigkeit zahlreicher Erkrankungen, die eine erhöhte Mortalität bedingen, nicht reduziert.
Aufgrund dieser Datenlage gilt so wie für die Vitamine A, B, C und E, dass eine Supplementierung mit Vitamin D in einer normal ernährten und ausreichend sonnenexponierten Bevölkerung keinen belegten Nutzen hat, aber einen finanziellen Schaden für den/die VerbraucherIn (nicht für den/die ProduzentIn) bringt.
Bei speziellen Gruppen, z.B. immobilisierten Personen und solchen in Altersheimen, liegen im Serum oft niedrige Vitamin D-Blutspiegel vor. Ist für diese eine Prophylaxe zweckmäßig? Es herrscht allerdings kein Konsens, ab welchem Vitaminspiegel von einem Mangel gesprochen werden soll (siehe 6). Unter 12 ng/ml (30 nmol/l) ist ein klarer Mangel gegeben, mit möglichen Folgen wie Rachitis und Osteomalazie, zwischen 12 – 20 ng/ml (30 – 50 nmol/l) können einige Personen ein Risiko haben (6) oder wie es die rezenteste englische Guideline ausdrückt: „may be inadequate for some people“ (6a). Auf jeden Fall zeigen die oben diskutierten Studien, dass auch unter 50 nmol/l (20 ng/ml) eine Vitamin D-Gabe die diskutierten Erkrankungen nicht beeinflussen kann. Die folgende Diskussion wird zeigen, wie eine Vitamin D-Prophylaxe für Erkrankungen des Knochenstoffwechsels (Osteoporose) und für Stürze aufgrund von Muskelschwäche zu bewerten ist.
Osteoporose und Stürze, Vitamin D und Calcium
Die Gabe dieser Kombination zur Prophylaxe und Therapie war bis vor wenigen Jahren unumstritten, inzwischen wurden widersprüchliche Daten publiziert. So fanden rezente Metaanalysen (3,4) keinen signifikanten Effekt dieser Therapie zur Verhütung von Knochenfrakturen bzw. zur Erhöhung der Knochendichte (7). Andererseits wurde in einer ausführlichen Cochrane-Analyse (8) zwar für Vitamin D alleine kein signifikanter Effekt, für die Kombination von Vitamin D und Calcium ein geringer, aber signifikanter Effekt (RR 0,84, CI 0,74 – 0,96) erhalten. Ursachen für die Diskrepanzen könnten darin liegen, dass nur höhere Dosen (ab 800 IU) von Vitamin D eine Frakturreduktion herbeiführen sollen (9) bzw. auch, dass nur bei Personen mit höherem Risiko, das sind z.B. HeimbewohnerInnen mit meist niedrigen Vitamin D-Blutspiegeln, ein signifikanter Effekt zu beobachten war (8,4). In Zahlen ausgedrückt (8): Für HeimbewohnerInnen, die ein Risiko von 54 Oberschenkelfrakturen pro 1000 pro Jahr haben, bewirkt die Prophylaxe eine Reduktion von 9 Frakturen, während für die „Normalpersonen“ (postmenopausale Frauen und ältere Männer) nur eine Reduktion von 8 auf 7 pro 1000 pro Jahr zu finden war (8).
Eine zusätzliche Unsicherheit für die Osteoporose-Prophylaxe ergab die Diskussion über ein kardiovaskuläres Risiko der Calciumsubstitution (siehe 10,11), u.a. ausgelöst durch eine Metaanalyse, die ein erhöhtes Myokardinfarkt-Risiko bei Calcium-Substituierung feststellte (12; siehe 13 für eine Metaanalyse, die kein Risiko fand). Auch hier könnte ein Dosisproblem vorliegen, da anscheinend erst eine totale (Diät plus Supplement) Calciumzufuhr von mehr als 1400 mg/Tag zu einem Anstieg kardiovaskulärer Erkrankungen (RR 1,4, CI 1,17 – 1,67) und Mortalität (HR 1,49, CI 1,09 – 2,02) führt (14).
Auch für Stürze liegen widersprüchliche Daten vor. Vitamin D hat einen positiven Einfluss auf die Muskulatur, bei durch Mangel geschwächter Muskulatur sollen Stürze gehäufter auftreten (15). Eine ausführliche Cochrane-Metaanalyse (16) von Interventionsstudien zur Verhinderung von Stürzen (14 Studien, 28.135 Personen) fand im Gesamten keine Reduktion der Sturzfrequenz durch Vitamin D, aber bei TeilnehmerInnen mit niedrigem Vitamin D-Serumspiegel (unter 30 nmol/l, 2 Studien) eine signifikante Reduktion (RR 0,57, 0,37 – 0,89), hingegen bei einem Blutspiegel von 32 - 50 nmol/l eine RR von 1,02 (CI 0,93 – 1,13). Eine Metaanalyse (17) von Studien an HeimbewohnerInnen (mit niedrigen Vitamin D-Spiegeln) fand ebenfalls eine Sturzreduktion durch Vitamin D.
Folgerungen für die Osteoporose
Aufgrund der diskutierten Datenlage ist eine generelle Supplementierung mit Vitamin D und Kalcium bei postmenopausalen Frauen und älteren Männern wegen eines fraglichen Nutzens einer solchen Prophylaxe nicht mehr zu empfehlen (siehe z.B. auch US Preventive Services Tack Force: 18, und European Guideline: 19). Es ist bemerkenswert, dass sogar in dieser klassischen Domäne von Vitamin D, i.e. der Osteoporose-Prophylaxe, ein Paradigmenwechsel eingetreten ist.
Für Calcium und Vitamin D ist diätäre Aufnahme (bzw. auch ausreichende Sonnenexposition) von 1000 mg/Tag bzw. 800 IU anzustreben. Bei Personen mit einem bekannten Risiko eines Vitaminmangels (z.B. in Altersheimen und bei Immobilisierung) kann eine Vitamin D-Gabe bei nachgewiesenem Mangel zweckmäßig sein. Wann ein zu korrigierender Mangel vorliegt, ist wie oben diskutiert kontroversiell und es gibt keine Studie, die für Osteoporose eine genaue Schwelle definieren lässt. Je mehr sich die Serumwerte unter 50 nmol/l (20 ng/ml) der Schwelle von 30 nmol/l nähern, umso mehr dürfte eine Osteoporose-Prophylaxe indiziert sein. Eine zusätzliche Calciumsupplementierung sollte die orale Gesamtaufnahme nicht über 1400 mg/Tag erhöhen.
Als negativer Effekt einer Calcium/Vitamin D-Prophylaxe wurde ein erhöhtes Nierensteinrisiko gefunden (siehe 5: HR 1,17, CI 1,02 – 1,34).
Im Rahmen einer Osteoporose-Therapie mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln ist eine Gabe von Calcium und Vitamin D (800 IU, bzw. bis zu 1400 mg Calcium) indiziert, da alle entscheidenden Studien mit dieser Basistherapie durchgeführt wurden. Zusätzlich kann es bei Mangel an Calcium unter der Therapie mit Bisphosphonaten (mehrere Präparate) und Denosumab (Prolia) zu seltenen, aber schweren Hypocalcämien kommen (siehe Fachinformationen).
Zusammenfassung
Eine breitgestreute Supplementierung mit Vitamin D wird immer wieder propagiert. Tatsächlich zeigen die neuesten Analysen insbesondere von Interventionsstudien keinen Nutzen bei den zahlreichen Erkrankungen, für die Beobachtungsstudien dies zu belegen schienen (siehe analoge Erfahrungen mit Vitamin A, B, C und E).
Für die Osteoporose-Prophylaxe ist eine Vitamin D-Gabe (plus Calcium, cave zu hohe totale Aufnahme) bei Personen mit einem hohen Risiko für einen Mangel bzw. besser bei nachgewiesenem Mangel zweckmäßig. Im Rahmen einer Osteoporose-Therapie ist sie indiziert.
Literatur:
(1) JAMA 309,2005,2013
(2) Lancet Diab End 2,76,2014
(3) BMJ 348,g2035,2014
(4) Lancet Diab End 2,307,2014
(5) Cochrane Database Syst Rev Issue 1,Art.CD007470,2014
(6) Am J Kidney Dis 64,499,2014
(6a) Age & Aging 43,592,2014
(7) Lancet 383,146,2014
(8) Cochrane Database Syst Rev Issue 4,Art.CD000227,2014
(9) NEJM 367,40,2012
(10) J Clin Hypertens 16,545,2014
(11) J Bone Met 21,21,2014
(12) BMJ 341,c3691,0,2010
(13) J Bone Min Res, Lewis Jr Jul 10,2014 (ahead of print)
(14) BMJ 346,f228,2013
(15) West Virg Med J 110,10,2014
(16) Cochrane Database Syst Rev Issue 9,Art. CD007146,2012
(17) Cochrane Database Syst Rev Issue 12,Art. CD005465,2012
(18) Am Fam Phys 89,896C,2014
(19) Osteoporose 24,23,2013
Medikamente bei Gicht (neue Substanz: Pegloticase: Krystexxa)
Der Medical Letter, eine kritische und unabhängige Zeitschrift in den USA, hat dieses Thema kürzlich behandelt (1). Im Folgenden werden wir Aussagen des Medical Letter fett ausdrucken und Bezug zu früheren Pharmainfo-Artikeln (siehe auch XXI/1/2006) nehmen.
Akuter Anfall
NSAR sind für eine erfolgreiche Behandlung geeignet. Es gibt keine überzeugenden Daten, dass Indomethacin (Indocid, Generika), ein „klassisches“ Gichtmittel, besser als andere NSAR wie Naproxen (Proxen, Generika) oder Ibuprofen (Brufen, Generika) wirkt (siehe Pharmainfo XXIII/4/2008).
Naproxen und Ibuprofen sind daher als Mittel erster Wahl und gegenüber Indomethacin, das mit mehr Nebenwirkungen (z.B. häufig Kopfschmerz) belastet ist, vorzuziehen.
Cortison: kurzzeitige Gaben von systemischen Corticosteroiden sind wirksam.
Colchicin (Colchicin Agepha) ist ein Reservemittel, wenn NSAR kontraindiziert sind, und zwar nur in niedrigen Dosen (1,2 mg gefolgt eine Stunde später von 0,6 mg: die für Colchicin Agepha angegebene Maximaldosis von 6 mg wird nicht empfohlen; siehe auch Pharmainfo XXIII/4/2008). Durchfälle sind eine typische Nebenwirkung (besonders bei höheren Dosen), selten Neuromyopathien.
Canakinumab (Ilaris): ein Reservemittel zur Behandlung von Gichtanfällen, wenn NSAR, Colchicin und Cortison nicht in Frage kommen. Dies entspricht auch der europäischen Zulassung. Da nicht geklärt ist, ob in solchen Fällen Ilaris wirksam ist, haben wir eine Verwendung nur im Rahmen klinischer Studien für angebracht gehalten (Pharmainfo XXIX/1/2014).
Chronische Gicht:
Urikostatika
Allopurinol (Urosin, Generika):
Eine asymptomatische Hyperurikämie sollte nicht mit diesem Mittel behandelt werden.
Dies ist eine wichtige Empfehlung, da Allopurinol zu schweren Hautreaktionen (einschließlich Stevens-Johnson-Syndrom) und Autoimmun Vaskulitis, die auch tödlich sein können, führen kann,.
In Europa ist Allopurinol der Hauptverursacher von Stevens-Johnson-Syndrom (siehe Pharmainfo XXVII/4/2012). Auch wenn diese schwere Nebenwirkung selten auftritt, ist eine unnotwendige Behandlung (asymptomatische Hyperurikämie) mit Allopurinol nicht vertretbar.
Es wird zwar immer wieder diskutiert, dass Hyperurikämie negative Konsequenzen, z.B. kardiovaskulärer Art haben kann (siehe z.B. 2), die vorliegenden Daten erlauben aber keine verlässlichen Schlüsse. Belegt ist nur, dass Hyperurikämie zu Gichtanfällen führt, allerdings ist die Frequenz von der Höhe der Serumspiegel abhängig: So zeigt eine Studie über 7,5 Jahre (3) ein erstes Auftreten von Gichtattacken nur bei 1,5% der PatientInnen mit einem Serumspiegel von 7-8,4 mg/dl, von 12,5% bei 8,5-9,9 mg/dl und von 45,5% bei mehr als 10 mg/dl. Wenn man also PatientInnen unter 10 mg/dl behandelt verhindert man bei 1,5% bzw. 12,5% den ersten Gichtanfall, 98,5% bzw. 87,5% werden aber einer offensichtlich unnotwendigen und in seltenen Fällen lebensgefährlichen Therapie ausgesetzt. Vertretbar ist (4: siehe Pharmainfo XXVII/4/2012) bei extrem hohen Spiegeln (Männer 13 mg/dl, Frauen 10 mg/dl bzw. bei einer Harnsäureausscheidung im Urin vonmehr als 400 mg/Tag) eine Therapie zu beginnen, um einen ersten Anfall und mögliche negative Folgen für die Niere zu verhindern bzw. um eine Bildung von Uratnierensteinen hintanzuhalten.
Febuxostat (Adenuric):
Auch für dieses Präparat wurden schwere Hautreaktionen wie Stevens-Johnson-Syndrom beobachtet.
Es bietet keine Vorteile gegenüber Allopurinol (siehe Pharmainfo XXVI/3/2011) und ist daher als noch wenig erprobtes und teures Präparat nur ein Reservemittel.
Pegloticase (Krystexxa):
Diese Substanz ist ein intravenös zu verabreichendes, pegyliertes Enzym (Uratoxidase), das Harnsäure in das leicht nierengängige Allantoin umwandelt. Es sollte nur bei schwerer, chronischer Gicht mit hohem Harnsäurespiegel und schmerzhaften Tophi angewandt werden, die auf keine andere Behandlung reagiert haben. Dies entspricht auch der europäischen Zulassung. Bei der Injektion kommt es häufig (>50%, siehe EPAR, EMA) zu allergischen Reaktionen bis zur Anaphylaxie. Es kann zur Entwicklung von Auto-Antikörpern kommen, die eine weitere Wirkung reduzieren. So zeigte eine Studie (5), dass es bei 41% der PatientInnen, die für 6 Monate alle 2 – 4 Wochen mit Pegloticase behandelt wurden, zum Auftreten hoher Spiegel von Antikörpern im Blut kam, die die Clearance von Pegloticase aus dem Blut beschleunigten und zu einem Wirkungsverlust für die Uratabsenkung führten. Dieses Phänomen schränkt die Nützlichkeit dieses Medikaments stark ein.
Wegen möglicher kardiovaskulärer Nebenwirkungen hat die EMA eine Sicherheitsstudie verlangt, die derzeit durchgeführt wird.
Aufgrund dieser Feststellungen ist dieses Mittel nur in den seltensten Fällen vertretbar, dafür spricht auch der extrem hohe Preis.
Literatur:
(1) Med Lett 56,22,2014
(2) Eur Rev Med Pharm Sci 18,1295,2014
(3) Clin Rheum 33,549,2014
(4) JAMA Int Med 174,1031,2014
(5) Arthr Res Ther 16,R60,2014
Medikamentöse Versorgung bei PatientInnen nach einem Herzinfarkt
Seit vielen Jahren ist etabliert, dass für PatientInnen nach einem Herzinfarkt 4 Medikamentengruppen klar indiziert sind: Thrombozytenaggregationshemmer, Betablocker, RAS (Renin-Angiotensin-System)-Hemmer und Statine. In der Pharmainfo des Jahres 1998 (XIII/1) mussten wir allerdings feststellen, dass keineswegs alle PatientInnen diese Sekundärprophylaxe erhielten, z.B. in den USA für Betablocker nur 40%.
In Europa wurde über die Jahre in drei Phasen (Euroaspire I: 1996, II: 2000, III: 2007) die Verschreibungspraxis für diese Medikamente erhoben (siehe 1). Die Daten für DiabetespatientInnen in diesen Surveys wurden jetzt publiziert (2). Alle PatientInnen dieser Analysen wurden wegen einer akuten Koronarerkrankung hospitalisiert (65% mit einem akuten Herzinfarkt: 2). Die Daten wurden in 22 europäischen Ländern gesammelt, die für Deutschland wurden inzwischen separat publiziert (3), waren aber mit dem Gesamtkollektiv weitgehend vergleichbar. Als Sekundärprophylaxe erhielten 95,1% der PatientInnen einen Thrombozytenaggregationshemmer (vor allem Acetylsalizylsäure: Generika), 82,5% einen Betablocker, 69% einen RAS-Hemmer und 80,7% ein Statin (1,2). Für DiabetikerInnen unter diesen PatientInnen waren die Werte ident, nur für RAS-Hemmer war der Prozentsatz mit 77% höher (2). Gegenüber Euroaspire I (1996) waren die Prozentsätze für Thrombozytenaggregationshemmer, Betablocker und RAS-Hemmer um 10% gestiegen, für die Statine aber um 40% (2). Allerdings erhielten nur 44% der PatientInnen (50% bei DiabetikerInnen) alle 4 Medikamente (2).
Es ist anzunehmen, dass im Laufe der letzten Jahre sich diese Zahlen noch erhöht haben. Grundsätzlich erscheint das Ausmaß der Verschreibung - es gibt ja auch Kontraindikationen – adäquat, für RAS-Hemmer und Statine scheint aber noch ein Defizit vorzuliegen, z.B. ist ja bei DiabetespatientInnen schon bei erhöhtem koronaren Risiko ein Statin auf jeden Fall indiziert (siehe Pharmainfo XX/3/2005).
Nach dieser positiven Feststellung zeigte aber die Fragestellung wie erfolgreich diese Therapie war, ein weniger zufriedenstellendes Bild (2). Wir haben keine Daten (siehe allerdings unten für Daten aus Österreich: 4), um die Effizienz dieser Therapie zu bewerten, insbesondere wie erfolgreich die Verhinderung von koronaren Ereignissen bei diesen PatientInnen war, wir können aber eine ausreichende Wirkung der Medikamente mit Parametern wie Blutdruck und Cholesterinspiegel feststellen. Wenn wir für Betablocker und RAS-Hemmer als Maß für den Therapieerfolg die Höhe des Blutdrucks nehmen, dann wurde die Grenze von 140/90 mmHg nur von etwa über 50% der PatientInnen unterschritten, ein Wert von 150/100, der heute für PatientInnen im Alter über 60 Jahren als Therapieziel ausreichen soll (siehe Pharmainfo XXIX/3/2014), nur von über 70%.
Bei LDL-Cholesterin gelang eine Absenkung unter den erwünschten Wert von 70 mg/dl nur bei über 10%, unter 97 mg/dl bei 40%. Bei DiabetikerInnen war die Blutdrucksenkung etwas geringer, die erreichten Cholesterinspiegel aber etwas niedrieger. Für letztere PatientInnen sind auch die Resultate für HbA1c interessant: unter 6,6% nmol/l kamen bei antidiabetischer Therapie 20%, unter 7,0 nmol/l (ein Wert, der rezenten Empfehlungen entspricht: 5) 50%. Für Österreich zeigen Daten aus dem Jahr 2007 (4), dass die Versorgung mit den oben angeführten Medikamenten ähnlich, aber etwas niedriger war (4). Diese Studie belegt aber zusätzlich, wie wichtig diese Therapie für PatientInnen nach Herzinfarkt ist: Diejenigen, für die nur 2 Medikamente verschrieben wurden, hatten gegenüber denen, die 3 – 4 Medikamente erhielten, eine um den Faktor 2,23 (95% CI: 1,19 – 4,18; p = 0,012) höhere Mortalität.
Bei mangelndem Therapieerfolg denkt man als Ursache vor allem an eine unzureichende Compliance der PatientInnen. In dieser Studie (2) behaupteten aber mehr als 97% der PatientInnen, dass sie „nie oder selten Tabletten nicht einnahmen“. Dies erscheint äußerst unwahrscheinlich und eine einfache Frage an die PatientInnen dürfte auch keine verlässlichen Daten liefern.
Ein unzureichender Therapieerfolg kann u.a. aber auch auf nicht ausreichende Dosierung oder auf die Notwendigkeit zusätzlicher Medikamente hinweisen.
Zusammengefasst: Die Entwicklung über die Jahre zeigt, dass in der Sekundärprophylaxe des Herzinfarktes die Verschreibung der 4 wesentlichen indizierten Medikamentengruppen (Thrombozytenaggregationshemmer, Betablocker, RAS-Hemmer und Statine) deutlich zugenommen hat und nahezu als ausreichend angesehen werden kann.
Bezüglich des Therapieerfolges zeigen allerdings die Daten, dass bei mehr als der Hälfte der PatientInnen die Medikamente nicht ausreichend wirksam waren. Der erste wichtige Schritt in der Therapie, die Verschreibung des richtigen Medikaments, ist – drastisch ausgedrückt – aber nutzlos, wenn es nicht gelingt, durch laufende Kontrolle der notwendigen Dosis, der Erforderlichkeit zusätzlicher Medikamente und insbesondere der Compliance der PatientInnen einen Therapieerfolg sicherzustellen. Eine völlig analoge Situation haben wir kürzlich für die Hochdrucktherapie beschrieben (siehe Pharmainfo XXIX/3/2014).
Literatur:
(1) Eur J Card Prev Reh 16,121,2009
(2) Prev Card online, Gyberg
(3) Deutsches Ärzteblatt 109,303,2012
(4) Eur J Epid 22,145,2007
(5) Eur Heart J 34,2949,2013
P.b.b. Erscheinungsort Verlagspostamt 1010 Wien
Montag, 22. Dezember 2014
Pharmainformation
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.




